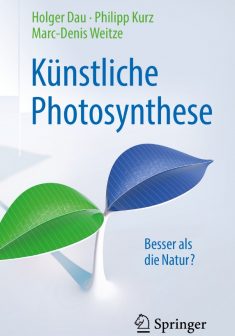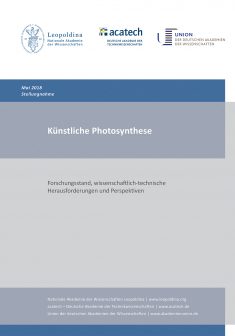Anwendungsmöglichkeiten und Perspektiven der Biotechnologie

München, 1. Oktober 2022
Biotechnologie ist aus unserem Alltag nicht wegzudenken: Pharmazeutika und Impfstoffe, Biokraftstoffe und Feinchemikalien sind genauso Produkte der Biotechnologie wie Brot, Wein oder Bier. Passend zum Oktoberfest gab „acatech am Dienstag“ am 27. September deshalb Einblicke in die Bierforschung – und ging der Frage nach, ob die Lederhose in Zukunft aus Pilz bestehen könnte. Die ganze Bandreite der Biotechnologie machte der letzte Vortrag des Abends deutlich: Der Chemiker Thomas Haas zeigte, wie mittels künstlicher Photosynthese nachhaltige Feinchemikalien hergestellt werden können.
Mit Aussagen wie „Bier ist doch schon so alt, was gibt es denn da noch zu erforschen“ wird acatech Mitglied Thomas Becker, Lehrstuhl für Brau- und Getränketechnologie an der TU München, regelmäßig konfrontiert. Dass am Bier noch heute viel geforscht wird, obwohl das Reinheitsgebot seit 1516 besteht und in Deutschland gebraute Biere nur aus Wasser, Malz, Hopfen und Hefe bestehen dürfen, zeigte er an zahlreichen Beispielen. So werde einerseits versucht, Hefe-Zellen, die nur unter Stress und in alten Zellen die wohlschmeckenden Aromen produzieren, länger und zielgenauer in dieser Phase zu halten. Andererseits könne KI für neue Datenmodellierungen genutzt werden, um so bereits während des Brauprozesses präzise Aussagen zur Qualität zu treffen. Alkoholfreies Bier stelle aufgrund der nachträglichen Wegnahme des Alkohols besondere Anforderungen an die Sensorik. Hierzu beschrieb Thomas Becker unterschiedliche sensorische Panels, um bspw. durch die Zugabe von Capsaicin, unterhalb der Geschmacksschwelle, den Aromaeindruck zu verbessern. Viele der beschriebenen Innovationen könnten bereits international eingesetzt werden, jedoch stellten die europaweit geltende Novel-Food-Verordnung und das Reinheitsgebot für viele Innovationen am Bier eine Hürde dar.
Vom Bier zum Pilz ist kein so weiter Weg, wie Vera Meyer (TU Berlin, acatech Mitglied) zu Beginn ihres Vortrages verdeutlichte. Während Brauereien auf einzellige Hefen angewiesen sind, nutzt die Pilz-Biotechnologie mehrzellige Pilze. So mag es für viele überraschend erscheinen, dass der größte Organismus der Welt und Europas kein Tier ist, sondern ein Honigpilz aus der Gattung Hallimasch in der Schweiz, dessen Myzelien gigantische Ausmaße annimmt. Diese „Mülleimer der Natur“ zeichnen sich dadurch aus, dass sie als einzige Organismen in der Lage sind, pflanzliche Materialien (auch deren Reststoffe) vollkommen zu verwerten. Neben den bereits genutzten Anwendungsfeldern zur Herstellung von Pharmazeutika oder Feinchemikalien fokussiert sich die Forschung von Vera Meyer auf die Herstellung von Leichtbaumaterialien wie Leder, Textilien, Möbeln oder Verpackungsmaterialien. Sie sieht ein enormes Potenzial in Pilzen als „hidden champions“, insbesondere durch deren Beitrag zu zehn der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Die Herstellung von neuen, sehr stabilen, wasserabweisenden und gleichzeitig leichten Kompositmaterialien ist aktuell noch in der Erprobung, kann aber bereits heute im Futurium in Berlin begutachtet werden. Der Clou an diesen neuen Materialien liege besonders in ihrer vollständigen Kompostierbarkeit am Ende der Nutzungszeit, so Vera Meyer in ihrem Fazit.
Weg von den Pilzen hin zu den Bakterien: die Künstliche Photosynthese war Thema des anschließenden Vortrags von Thomas Haas (Evonik Operations GmbH, Evonik Creavis). Das von ihm geleitete Rheticus-Projekt betreibt bereits seit drei Jahren eine Pilotanlage in Marl, in der das Prinzip der Künstlichen Photosynthese in der Praxis erprobt und eingehender erforscht wird. Hierbei wird die pflanzliche Photosynthese in zwei Teile aufgetrennt. Aus Sonnenenergie wird mittels Elektrolyse Wasserstoff gewonnen, dieser wird im zweiten Teil unter anaeroben Bedingungen, d. h. unter Ausschluss von Luftsauerstoff, von Bakterien genutzt. Diese stellen unterschiedliche Feinchemikalien her, welche als Öl-Additive oder in Pflegeprodukten erdölbasierte Produkte ersetzen. Ein hervorzuhebender Vorteil dieses Verfahrens sei laut Thomas Haas der Umstand, dass in diesem Produktionsprozess keine Wärme als Nebenprodukt entstehe. Im aktuell laufenden, BMBF-geförderten Kopernikus-Projekt werden die Anwendungsmöglichkeiten der Künstlichen Photosynthese eingehender untersucht, um die Effizienz der Prozesse zu steigern und die Kombination aus negativem CO2-Abdruck und regenerativen Energien weiter zu optimieren.