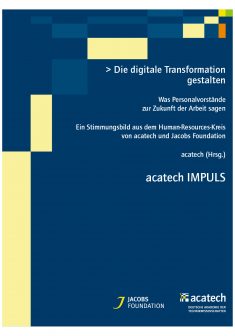Senatsveranstaltung: Wie Führungskräfte und Beschäftigte die Zukunft der Arbeit gestalten können

München, 8. Juli 2016
Die digitale Transformation führt in praktisch allen Wirtschaftsbereichen zu völlig neuen Geschäftsmodellen und stellt damit auch Belegschaften und Führungskräfte vor neue Aufgaben. Die Zukunft der Arbeit und der Führung war das Thema der acatech Senatssitzung am 8. Juli in München, an der Persönlichkeiten aus Unternehmen, Wissenschaftsorganisationen, Gewerkschaften, Verbänden und Politik teilnahmen. In seiner Sitzung wählte der acatech Senat Karl-Ludwig Kley in das Präsidium der Akademie.
acatech Präsidiumsmitglied Christoph M. Schmidt stellte die volkswirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung des digitalen Wandels heraus. Deutschland verfügt über mehr mittelständische Weltmarktführer als jede andere Volkswirtschaft, müsse jedoch Vorreiter der Industrie 4.0 werden, um sich im Spitzenfeld der innovativen Volkswirtschaften zu halten. Doch wie sieht die Zukunft der Arbeit aus? Darüber diskutierten anschließend auf dem Podium:
- Wolfgang Büchele (Linde AG, Vorsitzender des Vorstands)
- Jörg Hofmann (IG Metall, Erster Vorsitzender)
- Detlef Scheele (Bundesagentur für Arbeit, Vorstand Arbeitsmarkt)
- Isabell Welpe (TU München, Lehrstuhl für Strategie und Organisation)
Die Diskussion moderierte acatech Präsidiumsmitglied Dieter Spath, Vorstandsvorsitzender der Wittenstein AG. Die Diskussionsrunde unterstrich das Fazit des kürzlich erschienenen Bandes der Reihe acatech IMPULS über die Zukunft der Arbeit aus Sicht von Personalvorständen: Die Aus- und Weiterbildung muss gestärkt und flexibilisiert werden. Neben fachlichen Qualifikationen gehören IT-Kenntnisse, unternehmerisches Denken, betriebswirtschaftliches Wissen und Soft-Skills für die Arbeit in wechselnden Teams zum Rüstzeug der Arbeit 4.0. Neue Formen der Arbeitsorganisation müssen den flexiblen Prozessen der Industrie 4.0 gerecht werden. Im Vergleich zur klassischen Arbeitsteilung innerhalb von Unternehmen und zu etablierten Beziehungen zwischen Produzenten, Dienstleistern und Zulieferern werden wechselnde, gleichberechtigte Partnerschaften und selbstständige Arbeit immer wichtiger.
Zukunft der Arbeit – Zukunft der Führung
Joachim Wenning, Personalvorstand der Münchener Rück AG und deren designierter Vorstandsvorsitzender, leitete das zweite Thema der Senatssitzung ein: Wie sieht die Zukunft der Personalführung aus? Darüber diskutierten neben ihm:
- Ann-Kristin Achleitner (TU München, Lehrstuhl für Entrepreneurial Finance)
- Christin Eisenschmid (Intel Deutschland GmbH, General Manager)
- Christian P. Illek (Deutsche Telekom AG, Vorstand Personal)
- Till Reuter (KUKA AG, Vorsitzender des Vorstands)
Ein Fazit: Die Führungskultur ist ein Schlüssel für eine erfolgreiche digitale Transformation. Sie fördert die flexible Zusammenarbeit, dezentrale Entscheidungen und Unternehmertum auf allen Ebenen und lässt den Beschäftigten Raum zur Entfaltung ihres kreativen und innovativen Potenzials. Eine Herausforderung liegt im Management ambidextrer Strukturen in der Unternehmensorganisation: Nach dem Modell „eine Organisation – zwei Betriebssysteme“ müssen Führungskräfte vorhandene Stärken des Unternehmens ausbauen und zugleich agile Strukturen aufbauen, wie sie in IT- und Internetunternehmen verbreitet sind. acatech Präsident Henning Kagermann: „Vielen ist die Dringlichkeit dieses Wandels noch nicht bewusst. Führungskräfte sollten sich gerade deshalb als Change-Agents des digitalen Wandels verstehen, dessen Dringlichkeit und positives Potenzial sie deutlich machen.“
Die Senatorinnen und Senatoren wählten Karl-Ludwig Kley in das Präsidium der Akademie. Der frühere CEO der Merck KGaA ist Aufsichtsratsvorsitzender der E.ON SE. Der Jurist begann seine berufliche Laufbahn 1982 bei der Bayer AG. Dort leitete er das Ressort Finanzen von Bayer in Japan, den Geschäftsbereich Pharma der italienischen Bayer-Tochtergesellschaft und dann bis 1998 das Ressort Finanzen und Investor Relations der Bayer AG. Von 1998 bis 2006 war Kley Finanzvorstand der Deutschen Lufthansa AG, bevor er 2006 als Mitglied und stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsleitung zur Merck KGaA wechselte. 2007 wurde er dort Vorsitzender der Geschäftsleitung und CEO und vertrat das Unternehmen als Senator bei acatech.
Auf der anschließenden Abendveranstaltung kamen die Senatorinnen und Senatoren und die Mitglieder des Kuratoriums zusammen. Der Bayerische Wirtschaftsstaatssekretär Franz Josef Pschierer richtete sein Grußwort an die Senatorinnen und Senatoren von acatech. Er ging unter anderem auf die „Strategie BAYERN DIGITAL“ ein. Das Strategiepapier formuliert Handlungsempfehlungen der Akademie an die Bayerische Staatsregierung, die auf die Etablierung Bayerns zu einer globalen Leitregion der Digitalisierung abzielen.
Warum Roboterfußballern der Doppelpass schwerfällt
In seiner Dinner Speech blickte Wolfgang Wahlster in die Zukunft: „Für uns in Deutschland ist Künstliche Intelligenz nicht nur als persönlicher digitaler Assistent wichtig sondern entscheidend, um die nächste Stufe der Digitalisierung unserer Wirtschaft zu erreichen.“ Der CEO des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) skizzierte die Vision der KI-Forschung: „Es ist unser Ziel, eine die menschliche Intelligenz unterstützende, ergänzende oder auch komplementäre maschinelle Intelligenz zu entwickeln, so dass menschlicher und maschineller Intellekt zusammen Probleme lösen, die uns Menschen beschäftigen.“
Wolfgang Wahlster warnte aber auch vor Hype oder Panikmache: „Ich halte nichts von Singularitäts-Propheten und anderen Transhumanismus-Jüngern, die eine dem Menschen überlegene Superintelligenz als Vision propagieren und damit die Angst vor der Unterwerfung der Menschheit durch superintelligente Roboter schüren.“ Die Stärke der Maschinen liege im Bereich der kognitiven Intelligenz, während sie bei der sensomotorischen und sozialen Intelligenz noch weit zurückliegen. So sei das DFKI kürzlich erneut Weltmeister im Roboterfußball geworden. Doch Roboter „geben viel zu wenig ab und wollen lieber selbst die Tore schießen – die für ein wirkliches Teamplay notwendige soziale Intelligenz ist nur rudimentär realisiert”.