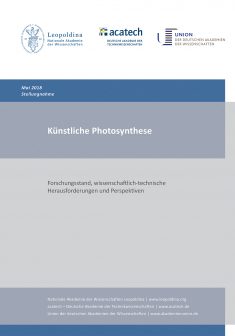Künstliche Photosynthese: Besser als die Natur?

München, 3. Mai 2019
Die Künstliche Photosynthese ist ein vielversprechender Ansatz für die nachhaltige, CO2-neutrale Produktion von Brenn- und Wertstoffen. 2018 haben die Wissenschaftsakademien dazu eine Stellungnahme herausgegeben. Mitglieder der Akademien-Arbeitsgruppe haben nun in einer Monographie aktuelle Forschungsthemen, Pilotprojekte und mögliche Hürden für die Umsetzung im Kontext der Energiewende und vor dem Hintergrund der „Fridays for Future“-Bewegung vorgestellt und bewertet. Perspektiven zur Künstlichen Photosynthese aus Wissenschaft, Kunst und Gesellschaft werden ausführlich erläutert.
Die Energiewende könnte an der „Dunkelflaute“ scheitern. Denn der weitere Ausbau von Wind- und Solarenergie, die derzeit rund 10 Prozent des deutschen Energiebedarfs decken, wird durch das Fehlen günstiger und effizienter Verfahren zur Speicherung großer Energiemengen stark eingeschränkt. Noch immer sind wir daher von einer Energieversorgung mit tiefschwarzen Wurzeln – den unterirdischen Lagern von Erdöl, Kohle und Erdgas – abhängig. Entstanden sind diese fossilen Ressourcen über Jahrmillionen, in denen Pflanzen Sonnenenergie mittels Photosynthese speicherten. Nun verbrennen wir sie innerhalb von Jahrhunderten und setzen damit große Mengen an CO2 frei. Könnten wir die fossilen Brenn- und Rohstoffe nicht durch regenerativ gewonnene Alternativen ersetzen?
Sonnenlicht wäre dafür die ultimative erneuerbare Ressource, denn die Sonne sendet ungefähr 15.000mal mehr Energie zur Erde als die Menschheit verbraucht. In der belebten Natur wird diese Energie über die Prozesse der Photosynthese vor allem zur Bildung energiereicher Kohlehydrate aus genutzt, die als Nahrung dienen und nach erfolgter Zellatmung wieder in Form von Wasser und CO2 freigesetzt werden – das Resultat ist ein perfekter, nachhaltiger globaler Kreislauf.
Warum sollten wir also nicht einfach Mutter Natur kopieren können und eine Künstliche Photosynthese entwickeln? Tatsächlich ist die Vision, chemische Energieträger und Wertstoffe (und nicht nur elektrischen Strom) unter Verwendung von Sonnenlicht zu produzieren, mehr als einhundert Jahre alt. Und massive Anstrengungen in den Laboratorien auf der ganzen Welt haben auch schon beachtliche erste Erfolge bei der Erforschung und Umsetzung dieses Menschheitstraums geführt.
Aber wie genau soll eine Künstliche Photosynthese funktionieren? Allgemein werden derzeit noch recht verschiedene Strategien verfolgt, um aus Wasser, CO2 (aus der Luft) und Sonnenlicht Roh- und Brennstoffe zu gewinnen. Am Anfang aller Routen steht jeweils die Trennung positiver und negativer Ladungsträger unter Verwendung von Sonnenlicht. Der so erzeugte energiereiche Zustand wird dann dazu genutzt, Elektronen von Wasser auf Protonen (Wasserstoffkerne) oder Kohlendioxid zu übertragen, wobei je nach Prozess schließlich Energiegase wie Wasserstoff oder Methan, aber auch flüssige Substanzen wie technisch wichtige Alkohole oder Kerosin produziert werden können. Dabei ganz wichtig: Anders als bei fossilen Ressourcen sind die Brennstoffe der Künstlichen Photosynthese CO2-neutral; es wird in Summe also kein zusätzliches CO2 in die Atmosphäre freigesetzt.
Die Künstliche Photosynthese ergänzt also herkömmliche Solarzellen, die Sonnenlicht in Strom umwandeln, über den wichtigen Aspekt der Speicherung. Während sich Strom nicht einfach im großen Maßstab lagern lässt, speichert die Künstliche Photosynthese die Energie des Sonnenlichts in chemischen Bindungen. Die Produkte lassen sich transportieren und lagern und können sowohl direkt als Brenn- und Treibstoffe als auch als chemische Grundstoffe verwendet werden.
So groß das Potential der Nutzung der Sonnenenergie ist, so groß sind aber auch noch die damit verbundenen Herausforderungen für Wissenschaft und Technik. Es gibt zwar beachtliche Forschungserfolge in Teilschritten der Künstlichen Photosynthese (diese beherrschen wir inzwischen teilweise effizienter als die grünen Pflanzen) – bis zum Einsatz in großem Maßstab ist es jedoch noch ein weiter Weg. Auf diesem sind aber nicht alleine wissenschaftlich-technische Herausforderungen zu meistern, auch die Gesellschaft ist gefragt. Denn der CO2-Reduktion und anderen langfristigen Vorteilen eines Ausstiegs aus fossilen Rohstoffen stehen kurz- und mittelfristig große finanzielle und organisatorische Belastungen gegenüber. Die Fridays-for-future Bewegung zeigt eindrücklich: Wichtig ist der gesellschaftliche Dialog – streitbar aber auch basierend auf Informationen bzw. Wissen zu den biologischen, chemischen und physikalisch-technischen Zusammenhängen. Hier sind auch Lehrer, Journalisten und andere „Multiplikatoren“ herausgefordert.
Die Künstliche Photosynthese kann helfen, die Energie- und Rohstoffsysteme klimafreundlicher zu gestalten. Das Ziel wurde mit der Mondlandung verglichen – Sonnenlicht so nachhaltig zu nutzen, wie wir es von der Biologie her kennen, bietet einen großen Erzählraum und benennt eine Vision, die jede Mühe wert ist.