Nachhaltige Landwirtschaft aus sozialethischer Perspektive – Ein Interview mit Markus Vogt
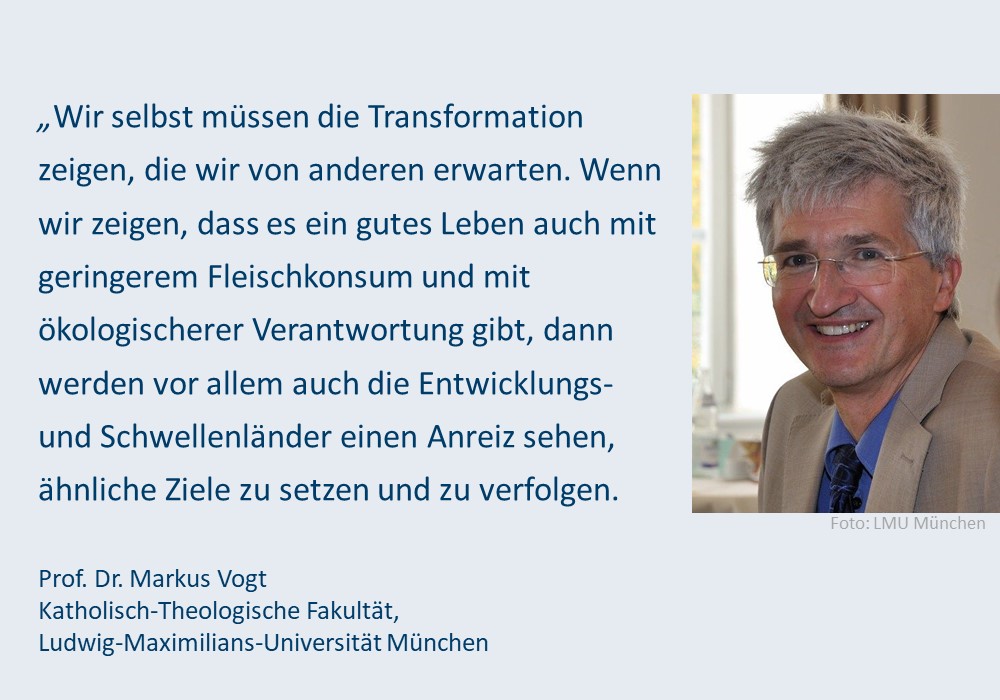
München, 15. November 2019
Es kriselt in der Beziehung zwischen Landwirten, Konsumenten und der Politik. Die Landwirtschaft fühlt sich in der öffentlichen Debatte missverstanden, ihre Verantwortung für die Gesellschaft als zuverlässiger Lieferant von Lebensmitteln wird von dieser kaum wahrgenommen. Wechselnd neue Anforderungen an unsere Lebensmittel und wie diese produziert werden sollten, stellen die Landwirte täglich vor neue Herausforderungen. Sie demonstrieren für ihr besseres Image und soziale Verbesserungen. Die soziale Anerkennung und Akzeptanz ist ein notwendiger Aspekt auf dem Weg in eine nachhaltige Landwirtschaft, jedoch noch kein hinreichender. Was notwendig ist, um die Ziele der nachhaltigen Landwirtschaft zu erreichen, erklärt uns der Sozialethiker Prof. Dr. Vogt im Interview mit acatech.
Herr Prof. Dr. Vogt, was bedeutet für Sie aus sozialethischer Perspektive nachhaltige Landwirtschaft?
Zunächst ist es entscheidend, zwischen den verschiedenen Dimensionen der nachhaltigen Landwirtschaft zu unterscheiden: Nachhaltige Landwirtschaft muss sowohl ökologisch ausgewogen, ökonomisch tragfähig als auch sozial verträglich sein. Die Landwirtschaft muss ihre Ressourcen aktiv schützen, dabei muss sie aber weiterhin wirtschaftlich bleiben, d.h. dass sie den Landwirten und Landwirtinnen eine tragfähige Lebensgrundlage zum Fortführen ihrer Betriebe bietet.
Hinsichtlich der verschiedenen Dimensionen der Landwirtschaft ist es wichtig zu verstehen, dass diese meist additiv gesehen werden. Ich verstehe darunter allerdings eine Vernetzung der verschiedenen Dimensionen. Demnach ist ökologische Vernunft eng verknüpft mit ökonomischer und sozialer Vernunft; diese schließen sich also nicht aus, sondern bedingen sich gegenseitig. Es geht in der nachhaltigen Landwirtschaft darum, Synergien zu schaffen. Das passiert noch zu wenig.
Sind die verschiedenen Ziele nachhaltiger Landwirtschaft gleichzeitig zu erreichen?
In erster Linie gilt es, einen Kompromiss zu finden, der alle Dimensionen der Nachhaltigkeit möglichst gut abdeckt. Nachhaltigkeit ist allerdings kein Harmoniekonzept, sondern ein normatives und ein Konfliktkonzept. Man kann also in Fragen der Nachhaltigkeit nie alles gleichzeitig erreichen, man muss abwägen und wissen, was im konkreten Fall Priorität hat. So ist beispielsweise heute mehr Tierwohl für Schweine, Kühe und Hühner aus ethischen Gründen geboten; dafür sind kurzfristig Mehrkosten in Kauf zu nehmen, was aber Systemrisiken von Krankheiten erheblich reduzieren kann und damit auch soziökonomisch Sinn macht. Ähnliches gilt für mehr Bodenschutz, der dringend gegen kurzfristige Teilinteressen einzelner Akteure zum Wohl aller durchgesetzt werden muss.
Was läuft aus Ihrer Sicht in der Landwirtschaft gut und was nicht?
Aus Perspektive der wirtschaftlichen Effizienz ist die Landwirtschaft im Allgemeinen eine Erfolgsgeschichte: Nie zuvor wurden so viele Lebensmittel produziert wie heute. Legt man den Fokus aber beispielsweise auf die soziale Frage und die soziale Gerechtigkeit, also die Arbeitsbelastung der Landwirtschaftsbetreibenden und die Lage einzelner Betriebe, zeigt sich ein anderes Bild. In den letzten zwei Generationen wurden rund zwei Drittel aller Höfe geschlossen. Auch die soziale Integration der Landwirte nimmt weiter ab. Die öffentliche Wahrnehmung des Landwirte-Berufs ist zunehmend negativ. Da herrscht viel Unverständnis. Das lässt sich auch in der aktuellen Debatte verfolgen. Dabei sind Land- und Forstwirte auch gleichzeitig „Wertewirte“, gestalten sie schließlich unsere Kulturlandschaft, pflegen Traditionen und haben oft ein enges Verhältnis zu Tieren und Pflanzen, mit denen sie täglich umgehen.
Woher kommt das Unverständnis?
Klar ist, dass die räumliche Distanz zwischen Konsumenten und Landwirt zu einer Art Bambi-Syndrom führt – ein idyllisches, aber entfremdetes Naturbild sowie ein romantisiertes Bild der Landwirtschaft. Durch die zunehmende Landflucht stimmt das Bild, welches viele Städter von der Landwirtschaft haben, nicht mit der Realität überein.
Darüber hinaus haben viele bei „dem Landwirt“ einen konservativen, rückwärtsgewandten Menschen vor Augen. Das ist so nicht korrekt. Viele Landwirte verwenden innovative, digitale und moderne Methoden, um ihre Betriebe zu bewirtschaften. So ist beispielsweise der Wertschöpfungsanteil digitaler Komponenten bei landwirtschaftlichen Maschinen mehr als doppelt so hoch wie bei deutschen Autos. Landwirte symbolisieren in gewisser Weise eine Schnittstelle an der deutlich wird, dass sich die Tradition und Moderne verbinden lassen.
Was sind, abgesehen von der sozialen Teilhabe der Landwirte, weitere Punkte, die Sie als besonders wichtig in einer nachhaltigen Landwirtschaft empfinden?
Wichtig ist vor allem, den Stellenwert der Biodiversität zu beachten. Die Berücksichtigung der Biodiversität muss stets eine Grundbedingung sein. Landwirtschaft ist der Schlüssel zu Biodiversität – für eine schöne Landschaft, sauberes Wasser und nachhaltige Rohstoffe. Sie stellt auch einen kritischen Faktor für die Überlebensfähigkeit unserer Zivilisation dar. Wir haben die Grenzen unseres Planeten („Planetary Boundaries“) überall längst überschritten. Ein Grund dafür ist unter anderem die Überdüngung, welche in direkten Zusammenhang mit der Landwirtschaft steht. Wenn wir die Grenzen unseres Planeten respektieren wollen, müssen wir dringend die Art, wie wir Landwirtschaft betreiben, verändern.
Welche Aufgaben sehen Sie auf dem Weg in eine nachhaltige Landwirtschaft bei den verschiedenen Akteuren?
Zuerst ist es besonders wichtig, zu verstehen, dass nachhaltige Landwirtschaft eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung ist, bei der sehr viele Akteure in einem komplexen Zusammenspiel interagieren. Die Politik muss zudem den Mut besitzen, härtere Grenzen zu ziehen. Das kommt auch dem Wunsch der Bevölkerung nach. Pflanzenschutzmitteleinsatz muss klar begrenzt sein und starke Standards im Tierschutz sowie in Bezug auf Lebensmittel müssen gesetzt werden. Hier sind wir auch international in der Verantwortung, hohe Standards einzuhalten und bei Missachtung Konsequenzen zu ziehen, indem solche Lebensmittel nicht zum Import freigegeben werden.
Ein weiteres Handlungsfeld, welches Gesellschaft und Politik für eine nachhaltige Zukunft stärker forcieren müssen, ist die Kreislaufwirtschaft („Circular Economy“). Wir müssen unsere Abfälle und Ressourcen wiederverwenden, denn unsere aktuelle Wegwerfkultur strapaziert die Grenzen unseres Planeten zu sehr und kann nicht fortgeführt werden.
Was möchten Sie dem Leser zum Schluss noch mitgeben?
Als westliche Industriestaaten haben die USA und Europa eine Vorbildfunktion bezüglich der globalen Zukunftsperspektiven einer nachhaltigen Landwirtschaft. Demnach müssen wir selbst die Transformation zeigen, die wir von anderen erwarten. Wenn wir zeigen, dass es ein gutes Leben auch mit geringerem Fleischkonsum und mit ökologischerer Verantwortung gibt, dann werden vor allem auch die Entwicklungs- und Schwellenländer einen Anreiz sehen, ähnliche (nationale) Ziele zu setzen und zu verfolgen. Klar ist, dass wir mit Maßnahmen für eine nachhaltigere Landwirtschaft nicht länger warten können. Der Zeitpunkt zum Handeln ist jetzt.

Prof. Dr. Markus Vogt ist seit 2007 Inhaber des Lehrstuhls für Christliche Sozialethik der Ludwig-Maximilians-Universität München. Ebenso ist er Mitglied der Wissenschaftsplattform Nachhaltigkeit 2030 sowie seit 2019 in der Europäischen Akademie der Wissenschaften. Im Rahmen der acatech HORIZONTE Publikationsreihe wirkte Herr Vogt an der Ausgabe Nachhaltige Landwirtschaft mit. Seine neuste Publikation „Ethik des Wissens – Freiheit und Verantwortung der Wissenschaft in Zeiten des Klimawandels“ erschien im Oktober 2019.
Die Beiträge im HORIZONTE logbuch geben die Meinungen und Experteneinschätzungen der Autorinnen und Autoren wieder und nicht Positionen von acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften.





