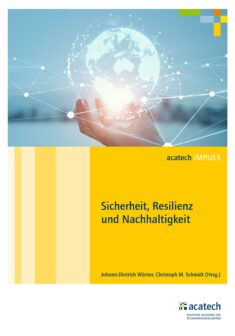Zeitenwende in den Technikwissenschaften? – acatech diskutiert das Thema Militärtechnik in der Evangelischen Akademie Tutzing
![acatech Präsident Jan Wörner, Pia Fuhrhop (Stiftung Wissenschaft und Politik) und Moderator Stephan Schleissing [v.l.n.r.] auf einer Tagung im Rahmen der Reihe „Innovation und Verantwortung“ in der Evangelische Akademie Tutzing zum Thema „Welche Militärtechnik braucht Europa?“. (Foto: acatech)](https://www.acatech.de/wp-content/uploads/2023/03/Foto-News_0053_Blur_1000x700.jpg)
Tutzing, 10. März 2023
Die sicherheitspolitische Lage in Europa hat sich verändert. Es gibt neue Bedrohungsszenarien, in denen auch die klassische Unterscheidung zwischen Krieg und Frieden immer schwieriger werden. Der „Strategische Kompass“ der Europäischen Union spricht von einer „Rückkehr der Machtpolitik in einer umstrittenen multipolaren Welt“. Er fordert gemeinsames Handeln und europäische Investitionen in technische Ausrüstung und Infrastrukturen. Doch was heißt das für die Technikwissenschaften, und welche Militärtechnik braucht Europa? Darüber diskutierten Fachleute auf der gemeinsamen Tagung von acatech und dem Institut Technik-Theologie-Naturwissenschaften der LMU München (TTN) sowie der Evangelischen Akademie am 27./28. Februar in Tutzing.
Krieg und Frieden – auch eine Frage an die Kirche

Der Direktor der Evangelischen Akademie Tutzing, Udo Hahn, betonte, dass auch in Fragen von Krieg und Frieden die evangelische Kirche ihre Perspektive beizutragen habe. Die Diskussion über Rüstung und militärtechnische Forschung sei notwendig, da andere Optionen aktuell nicht weiterführen. In Anlehnung an das Motiv der Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf der Münchener Sicherheitskonferenz verglich er den Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine mit dem biblischen Kampf von David gegen Goliath. Er beschreibe vordergründig die Verteidigung gegen einen stärkeren Gegner – der Kern sei die Überlegenheit klugen Handelns gegenüber roher Macht. So leitete er die Frage der Tagung ein: nach der (im Zuge der vielzitierten Zeitenwende veränderten) Rolle von Militärtechnik und damit verbunden von Wissenschaft und Technik.
Es braucht auch eine innerwissenschaftliche Debatte

acatech Präsident Jan Wörner erinnerte daran, dass eine starke Friedensbewegung und die wirtschaftlich wie friedenspolitisch getriebene Idee vom „Wandel durch Annäherung“ zu einer langen Phase der Entspannungspolitik geführt hatten. In diesen Jahrzehnten entwickelten Hochschulen und Forschungseinrichtungen Zivilklauseln, also Selbstverpflichtungen, ausschließlich für zivile Zwecke zu forschen. Jan Wörner riet, allzu kategorisch gefasste Zivilklauseln zu überdenken. Klar: Forschung sei auf friedliche Zwecke zu beschränken – allerdings gehöre dazu auch die Verteidigungsfähigkeit. Eine innerwissenschaftliche Debatte sei notwendig, denn die Entscheidung liege bei den Hochschulen.
Letztendlich müsse Deutschland gemeinsam mit seinen internationalen Partnern strategische Souveränität – sicherheitspolitisch wie wirtschaftlich – anstreben und dazu Sicherheit, Resilienz und Nachhaltigkeit systematisch stärken. Dabei sprach sich Jan Wörner für eine weit gefasste Auslegung des Sicherheitsbegriffs aus: Dieser umfasse nicht allein militärische Sicherheit, sondern „Safety“ und „Security“ im umfassenden Sinn, bestehend aus innerer und äußerer Sicherheit sowie Versorgungssicherheit und Betriebssicherheit. Wichtiger als spezifische Souveränitäten einzelner Akteure in einzelnen Teilbereichen sei die Freiheit jedes Landes, seine internationalen Partner frei zu wählen. Nationaler Egozentrismus sei nicht die Lösung, sondern eine Ursache aktueller Konflikte.
Zeitenwende in der Sicherheitspolitik: Herausforderung für Verteidigungsstrategie und Rüstungspolitik in Europa

Pia Fuhrhop von der Forschungsgruppe „Sicherheitspolitik“ der Stiftung Wissenschaft und Politik sprach über die internationale Sicherheitslage, strategische Antworten der EU, der NATO und Deutschlands sowie über rüstungspolitische Herausforderungen. Europa und Deutschland stehen nach ihren Worten unsichere und konfliktträchtige Zeiten bevor. Multipolarität, geopolitischer Wettbewerb und Krisen in der Nachbarschaft prägen das europäische Sicherheitsumfeld. Innere und äußere Sicherheit seien stärker miteinander verknüpft als bisher. Die große Nachfrage nach Beschaffung und Forschung sei europäisch zu bündeln und gemeinsam zu finanzieren. Damit dies gelingen kann, müsse die EU und müssen die Nationalstaaten die damit verbundenen Prozesse reformieren. Anders sei eine starke sicherheitspolitische Eigenständigkeit Europas nicht in Sicht. Neben europäischer Kooperation erfordere eine sicherheitspolitische Zeitenwende einen langen Atem und vor allem gute Konzepte. Einfach mehr Geld auszugeben, reiche nicht. Die Mittel müssen, so Pia Furhop, besser, also zielgerichteter und koordinierter eingesetzt werden.
Verteidigungsforschung und technologische Souveränität

Jürgen Beyerer, Institutsleiter des Fraunhofer IOSB und Vorsitzender des Fraunhofer-Leistungsbereichs Verteidigung, Vorbeugung und Sicherheit VVS, sah die in Deutschland übliche Trennung von ziviler und militärischer Sicherheit vor allem politisch begründet. Sicherheit sei jedoch ein unteilbares Konzept: Sie werde durch natürliche, technische, kriminelle, terroristische und militärische Gefahren bedroht und müsse deshalb auch über alle diese Bereiche hinweg geschützt werden. Sicherheit brauche also sowohl zivilen als auch militärischen Schutz. Fehle dieser an einer Stelle, dann sei Sicherheit insgesamt gefährdet. Ebenso seien Grenzen zwischen innerer und äußerer Sicherheit schwierig zu ziehen. Diesen Realitäten müsse nach seinen Worten auch die Forschung und ihre Förderung Rechnung tragen: Statt künstliche Trennungen aufrecht zu erhalten, müsse sie Synergien nutzen. Dual-Use könne nicht kategorisch ausgeschlossen werden. Denn viele Technologien stünden durch Open Source sämtlichen Interessensgruppen zur Verfügung. Wie neue Technologien auch die Militärtechnik verändern, zeigte er an einer Vielzahl von Beispielen. Die Quantenforschung ermögliche neue Formen abhörsicherer Kommunikation und des Quanten-Imaging: Detektionssysteme, die vom Überwachten nicht erkannt werden können.
Die Verteidigungsforschung muss nach Einschätzung von Jürgen Beyerer massiv gestärkt werden. Nur so könne sie mit einem beschleunigten Technologischen Wandel Schritt halten. Dies bedeute, dass Deutschland eine starke eigene Forschung, Entwicklung und Anwendung in solchen Schlüsselfeldern braucht.
Ethische Herausforderungen von KI in bewaffneten Konflikten

Hartwig von Schubert fragte nach ethischen Herausforderungen des digitalen Wandels in bewaffneten Konflikten. Der Lehrbeauftragte am Institut für Systematische Theologie der Universität Hamburg und ehemalige evangelische Militärdekan an der Führungsakademie der Bundeswehr Hamburg beschrieb sein Anliegen: In der Entwicklung digital gestützter militärischer Führung seien die rechtsethischen Prinzipien des humanitären Völkerrechts, die Regeln des Haager und Genfer Rechts, auch in den Systemarchitekturen moderner Waffensysteme zu verankern. Wo Waffensysteme KI nutzen, müssen immer noch Menschen entscheiden, wie sie eingesetzt werden. Der erfolgreiche Einsatz sei regelmäßig empirisch zu belegen. Klare hierarchische Ebenen dienen dazu, auch im Falle zeitkritischer Automatisierung von Funktionsabläufen deren Wirkung klar und verbindlich einzugrenzen. Dabei solle Deutschland mit gutem Beispiel vorangehen, unabhängig davon, ob sich international ein Konsens über die Maßstäbe und Grenzen des Einsatzes von KI in Waffen und Systemführung ein Konsens herausbilde. Es dürfe nicht zu einem digitalen Rüstungswettlauf mit Risiken katastrophalen Ausmaßes kommen. Vernünftige Regierungen müssen sich deshalb auf Maßnahmen der Rüstungskontrolle und der Abrüstung einigen, auch bei der Einführung von KI in der Militärtechnik, so Hartwig von Schubert.
Sicherheitsforschung an einer besonderen Universität

Anhand einer „besonderen Universität“, nämlich der Universität der Bundeswehr München, zeigte Merith Niehuss als deren ehemalige Präsidentin auf, wie Sicherheitsforschung strategisch gedacht werden könne. Die Bundeswehr-Universität forsche umfassend über Sicherheitsfragen und habe ein Zentrum für Cybersicherheit mit eigenem Rechenzentrum aufgebaut (CODE), erforsche Satellitenkommunikation und -navigation (SPACE), forsche im Bereich Luftfahrt und schlage dabei die Brücke zwischen militärischem und zivilem Bereich. Den Technologietransfer zwischen Grundlagenforschung und Anwendung bis hin zur Unternehmensgründung und zwischen militärischer und ziviler Technologieentwicklung stärke das neue „dtec.bw – Zentrum für Digitalisierungs- und Technologieforschung der Bundeswehr“.

acatech Mitglied Manfred Hennecke ging in seinem Kommentar unter anderem auf den Umgang mit der Zivilklausel an Hochschulen und Rolle militärischer Forschung in der deutschen Forschungslandschaft ein. Die fehlende Integration militärischer Forschung in das Wissenschaftssystem habe viele Nachteile. Generell sei es nicht sinnvoll, militärbezogene Forschung verbreitet und kategorisch auszuschließen und sie pauschal in eine, auf dieser Tagung viel zitierte, „Schmuddelecke“ zu stellen. Sicherheit und Souveränität erfordern nach seinen Worten sowohl zivile wie militärische Forschung auf höchstem Niveau, also sei diese Forschung auch in das deutsche Forschungssystem zu integrieren.
Forschung für militärische Zwecke? Zur Ethik sicherheitsrelevanter Forschung
Den ersten Tagungstag beschloss eine Podiumsdiskussion, moderiert von Klaus Mainzer (acatech Mitglied, TU München). Im Mittelpunkt standen die ethischen Fragen rund um die Forschung für militärische Zwecke. Friedrich Lohman, Professor für Evangelische Theologie an der Universität der Bundeswehr München erörterte eingangs das Spannungsfeld zwischen Ethik, militärischen Zwecken und Forschung. Therese Feiler, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut TTN der LMU München, stellte fest, dass bereits bestimmte ethische Vorstellungen in der Technik enthalten seien. Diese seien zu analysieren und gegebenenfalls auch nah an der Technik zu kritisieren. Weiter erläuterte sie, dass auch in der theologischen Ethik der Politik, zu der Militär und die damit verbundene Technik gehören, noch offene Fragen bestünden, beispielsweise Fragen nach der Rolle des Kämpfens und zur Vorstellung von Sieg und Opfern. Friedrich Lohmann, Professor für Evangelische Theologie an der Universität der Bundeswehr führte den Gedanken weiter aus: Ethik gebe nicht Antworten, sondern begleite Entscheidungsprozesse. Die Zivilklausel stehe dafür, dass militärische Forschung einen anderen Status habe als zivile Forschung und deshalb anders begleitet werden müsse. Auch Martin Schulte, acatech Mitglied und Professor für Öffentliches Recht an der TU Dresden, sprach sich für eine Prozedualisierung des Problems aus, die sich wie folgt beschreiben lässt: Grundsätzlich ist Wissenschaft autonom. Die damit verbundene Selbstkontrolle entspricht der Auffassung des Grundgesetzes, erinnerte Martin Schulte. Falls die Forschungsfreiheit in Kollision gerät mit anderen Grundrechten, muss ein Abwägungsprozess stattfinden.
![Friedrich Lohmann (Universität der Bundeswehr, München), Therese Feiler (Institut TTN der LMU München), Moderator Klaus Mainzer, Martin Schulte (TU Dresden), Michael Zäh (iwb der TU München) [v.l.n.r.]](https://www.acatech.de/wp-content/uploads/2023/03/Podium-Tag1_0179_800x250.jpg)
In seinem Fachgebiet sei fast jegliche Forschung Dual-Use, konstatierte Michael Zäh, Institut für Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaften (iwb) der TU München. Forschung zu Militärtechnik sei generell nötig und geboten: Wer Soldatinnen und Soldaten in Auslandseinsätze schicke, stehe in der Verantwortung, für deren bestmögliche Ausrüstung zu sorgen. Dem Dual-Use-Problem könne sich die Forschung ohnehin nicht entziehen, sobald sie mit Unternehmen zusammenarbeitet, die auch im Rüstungsbereich aktiv sind.
European Defense Collaboration – Europäische Zusammenarbeit im 21. Jahrhundert

Nach einem intensiven ersten Tagungstag mit einem Fokus auf Wissenschaft, Forschung und ethischen Aspekten, stellte der zweite Tag in Tutzing zunächst die Perspektive verschiedener Unternehmen in den Mittelpunkt. Florian Keisinger (Airbus Defence and Space) fokussierte sich auf FCAS (Future Combat Air System), einem europäischen Verteidigungsprogramm: Ziel des Programmes ist, eine gemeinsame europäische Luftverteidigung basierend auf Flugzeugen, Drohnen und Radartechnologie aufzubauen. Die geringe Anzahl an beteiligten Nationen (Deutschland, Frankreich und Spanien) zeige jedoch die Herausforderungen abgestimmter Rüstungsprojekte innerhalb der EU sehr deutlich – viele Projekte stellen eher transnationale Kooperationen dar als abgestimmte gesamteuropäische. In seinem Beitrag machte Florian Keisinger weiter deutlich: Gezielte Zusammenarbeit sei politisch gewollt, jedoch noch nicht der Realität der Rüstungskooperationen gelebt. Auch seien laut Florian Keisinger die aufwändigen Abstimmungsprozesse bei Exporten noch immer ein Hemmschuh für schnelles, agiles Reagieren der Nationen innerhalb der EU.
Die Rolle nationaler Industriekonsortien für die Entwicklung von Militärtechnik

Neben transnationalen Projekten in der Rüstungsindustrie gibt es auch eine intensive Zusammenarbeit deutscher Unternehmen, wie Armin Brandstetter (Sprecher FCMS, Hensoldt AG) in seinem Vortrag verdeutlichte. Disruptive Innovationen entstünden heutzutage in erster Linie als zivile Technologien und werden anschließend militarisiert. Die militärische Weiterentwicklung von Technologien wie 3D-Druck, Quantencomputing und KI könne quasi von „jedem“ geschehen. Um mit den sehr schnellen technologischen Entwicklungszyklen Schritt halten zu können, werden nach seinen Worten neue Kooperationen aus unterschiedlichsten Playern erforderlich. Armin Brandstetter verwies darauf, dass eine Militarisierung neuer technologischer Entwicklungen kaum aufzuhalten sei, daher der Schutz vor zunehmenderMilitarisierung von Zukunftstechnologien essentiell sei. Er unterstrich, dass ethische Fragen Einzug nehmen müssen in die Entwicklung von militärischen Systemen und bereits beim Systemdesign von Maschinen berücksichtigt werden. Eine Möglichkeit sei es hier sich auf grundlegende Standards zu einigen. Ein aktuell, von den zum nationalen Konsortium FCMS (Future Combat Mission System) zusammengeschlossenen Unternehmen (Hensoldt, Diehl Defence, Rohde & Schwarz und ESG), genutzter Standard sei „IEEE Standard Model Process for Addressing Ethical Concerns during System Design“. So könne möglicherweise erreicht werden, dass KI in militärischen Systemen auch deeskalierend wirkt.
Open Source Intelligence – Chancen und Herausforderungen für Lagebilder der Zukunft

Stefan Vollmer (ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH) stellte Entwicklungen hin zu Open Source Intelligence (OSINT) ein aktuelles Trend-Thema im Bereich Defence in den Mittelpunkt. Durch die Digitalisierung des Alltags und den weit verbreiteten Einsatz von Social Media fallen Unmengen an Daten an. OSINT basiere auf dem Zugriff auf Informationen, die aus freiverfügbaren und für jeden zugänglichen Quellen gewonnen werden können und in gezielte Auswertung, einen „Intelligence Cycle“, einfließen können. Die Masse an gesammelten Daten müsse gezielt analysiert werden, Muster erkannt und über Feedbackmechanismen weiter geschärft werden. Die effiziente und zielgerichtete Evaluation, begleitet durch einen Validitäts-Check der Informationen, sei dabei entscheidend. Gewonnene Informationen ließen sich bereits im Vorfeld strategisch einsetzen, zur Krisenfrüherkennung, um Lagebilder vor Ort exakter erstellen und bedarfsgerechte Informationen zielgerichtet bereitzustellen.
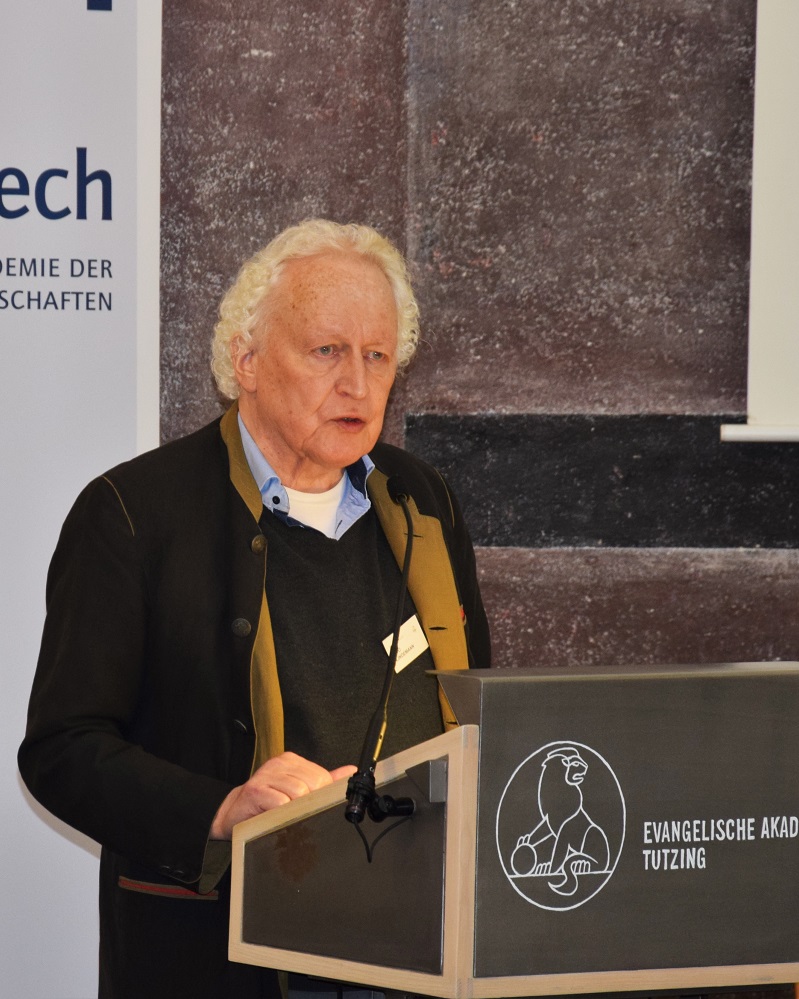
Die zuvor beschriebenen Entwicklungen kommentierte acatech Mitglied Udo Lindemann (TU München). Durch extrem schnelle technologische Entwicklungszyklen müsse ein Maß zwischen Schnelllebigkeit und langfristigen Entwicklungen gefunden werden. Dies werfe neue Fragen nach der Priorisierung von Investitionen auf: Wie sehr lohnen sich vermeintlich teure Technologien, und wie lange können diese genutzt werden? Insbesondere angesichts der rasanten Entwicklung neuer Systeme seien das drängende Fragen.
Technik und Gesellschaft: Herausforderungen der Militärtechnik

Michael Decker (Bereichsleiter „Informatik, Wirtschaft und Gesellschaft“ am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), acatech Mitglied) schloss die Tagung, indem er einen Bogen spannte von den Herausforderungen an die Militärtechnik bis hin zu gesellschaftlichen Debatten, die die neuen Sicherheitsfragen und der Einsatz von KI im militärischen Bereich aufwerfen. Technikfolgenabschätzung sei hier wichtiger denn je. Technikfolgenabschätzung sollte stehts innovationsbegleitend erfolgen. Gesellschaftliche, politische und ethische Fragen müssen bereits in die Entwicklung neuer Militärtechnik implementiert und entschieden werden. Eine nachträgliche politische Regulation hinke den Entwicklungen immer hinterher. In einem breiten gesellschaftlichen Dialog müssen in diesem Sinne ein kontextbezogener Handlungsrahmen entwickelt werden. Besonders kontroverse Themen wie die Militärtechnik erfordern eine besonders intensive, offene gesellschaftliche Debatte. Dabei greife es zu kurz, einfach Wahrnehmungsmuster von Techniken in Umfragen zu ermitteln: Oftmals seien die Fragen bereits verworren oder sogar suggestiv, sodass die Antworten nicht mehr offen gegeben werden.
acatech Präsident Jan Wörner zog ein Fazit der Tagung: Sie habe keine abschließenden Antworten geliefert, aber den übergreifenden Diskurs zwischen Technik, Industrie, Forschung und Ethik vorangebracht. Er betonte das aufgezeigte Spannungsfeld zwischen universitärer Forschung und wirtschaftlicher Nutzung. Wichtig sei es zu klären, wo die Verantwortung liege. Hierfür seien ethische Maßstäbe wichtig. Die Frage sei: Wer legt dabei die Entscheidungskriterien fest? Solle Ethik begleiten oder die Orientierung sein? Die zahlreichen aufgeworfenen Fragen müssen und können nicht auf einer zweitägigen Tagung beantwortet werden, so Jan Wörner. Sie bereichern aber den vertiefenden Dialog zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft über sicherheitstechnische Entwicklungen.
Antworten unserer Referentinnen und Referenten zum Thema Militärtechnik
Wo sollte die Forschung für die Militärtechnik durchgeführt werden?
Klaus Mainzer: So weit als möglich an öffentlichen Hochschulen und Universitäten, um so auch Aufklärung und Sensibilität in der Gesellschaft für Sicherheitsfragen zu erzielen. Je nach Forschungsprojekt sind besondere Sicherheitsauflagen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (z.B. Vertraulichkeitserklärungen) zu erfüllen. In der Demokratie unterliegt allerdings der gesamte Forschungsbereich für die Militärtechnik der Kontrolle durch das Parlament.
Merith Niehuss: An einem sicheren Ort. Allerdings sind die wenigsten Hochschulen sichere Orte für sensible Sicherheitsforschung.
Armin Brandstetter: Da sich Forschung primär mit den Grundlagen beschäftigt, diese zivil und militärisch aber nicht mehr trennbar sind, kann die Frage dazu nicht wirklich beantwortet werden. Grundlagen sollten in Forschungseinrichtungen erarbeitet werden. Nur da, wo es anwendungsspezifische Abweichungen gibt, sollte ein Übergang stattfinden – über die anwendungsspezifische Forschung (z.B. Bundeswehr Unis, Fraunhofer, DLR) in Richtung Implementierung/Umsetzung durch die Industrie. Es stellt sich die Frage, gibt es Militärtechnik spezifische Forschung im historischen Sinne überhaupt noch?
Hartwig von Schubert: Im europäischen Verbund.
Michael Decker: Ich denke, dass Militärtechnik außeruniversitär erforscht werden sollte. Das Fraunhofer INT macht beispielsweise wehrtechnische Zukunftsanalysen. In der Arbeitsteilung der außeruniversitären Forschung wäre auch die Helmholtz-Gemeinschaft geeignet. Sie forscht entsprechend ihrer Mission zu den großen und drängenden gesellschaftlichen Fragen.
Stefan Vollmer: In vielen Fällen lässt sich Militärtechnik nicht mehr von ziviler Technik trennen (dual-use). Deshalb sollte Forschung an allen Forschungseinrichtungen betrieben werden. Nicht unbedingt ausschließlich und konkret zu Militärtechnik, aber doch immer mit dem Weitblick, wie die Forschung zur inneren und äußeren Sicherheit Deutschlands beitragen kann.
Welchen Beitrag kann eine Hochschule zur Militärtechnik leisten? Soll sie hier überhaupt einen Beitrag leisten? Können Hochschulen die Sicherheitsanforderungen an Militär-bezogene Forschung gewährleisten?
Klaus Mainzer: Das hängt vom Forschungsthema und den Sicherheitsanforderungen ab, die eine Hochschule garantieren kann. Die beiden Bundeswehrhochschulen in Deutschland können die Sicherheitsanforderungen garantieren. Double-Use Forschung sollte an öffentlichen Hochschulen und Universitäten nicht ausgeschlossen, aber klar gekennzeichnet sein. Dazu sollten auch sozialwissenschaftlich und ethisch begleitende Ausbildung und Diskussionsforen durchgeführt werden.
Merith Niehuss: „Militärtechnik“ ist per se nicht die Forschungs-Aufgabe von Universitäten. Jedoch unterliegen unendlich viele Forschungsthemen, mit denen sich vor allem technische Hochschulen beschäftigen, dem Dual-Use Gedanken. Wenn wir unsere digitalen Daten oder unsere kritische Infrastruktur vor x-beliebigen Hackern sichern, sichern wir sie zugleich vor Angriffen feindlich gesinnter Staaten. Wenn wir an autonomen Fahrzeugen forschen, lassen diese sich auch für militärische Zwecke verwenden.
Armin Brandstetter: Abhängig von der Hochschule (Universitäten der Bundeswehr sind anders, als eine technische Universität). In der Grundlagenforschung gibt es noch wenig Militär-bezogene Forschung, dies ändert sich erst, wenn es näher an die Anwendung geht. Hier sind sicher in spezifischen Fällen Beiträge möglich. Aber auch hier verschwimmt Alles. Beispiel Ukraine und der Einsatz kommerzieller Drohnen. Eine Universität kann hier natürlich ohne militärischen Bezug die Optimierung von Drohnen vorantreiben, militarisiert wird sie erst durch eine „Umwidmung“ und den spezifischen Einsatz.
Hartwig von Schubert: Sie sollen es, weil in Deutschland die Streitkräfte die Streitkräfte der Gesellschaft sind. Sie können es, wenn sie und die tragenden Kräfte universitärer Forschung es wollen.
Stefan Vollmer: Zuerst einmal sollten sich auch „zivile“ Hochschulen für Militärtechnik öffnen. Teilweise bestehen immer noch Abwehrhaltungen gegenüber diesen Themen. Sogenannte Zivilklauseln in Hochschulgesetzen werden häufig gegen Militärtechnik ausgelegt, obwohl sie sich im Kern mit Nachhaltigkeit, Frieden und Demokratie beschäftigen. Diese Ziele schließen Militärtechnik in keiner Weise aus.