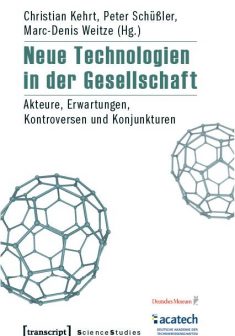Dialog im Deutschen Museum Nürnberg – Technikentwicklung zwischen Früherkennung und Gestaltung

Nürnberg, 18. Juli 2022
Wie sieht die Technik in 5, 15 oder 50 Jahren aus? Wohin hat sich dann die Gesellschaft entwickelt? Diese Fragen standen im Zentrum einer Diskussionsveranstaltung am 11. Juli, die erstmals im und mit dem Deutschen Museum Nürnberg ausgerichtet wurde. Fachleute aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft kamen vor Ort mit rund 60 Teilnehmenden ins Gespräch.
Fragen zu unserer Zukunft entspringen nicht nur reiner Neugierde – wenn man sie richtig beantwortet, verschafft man sich auch klare Vorteile: Unternehmen suchen den Technologievorsprung vor der Konkurrenz, die Politik möchte zur Förderung der volkswirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit aussichtsreiche neue Technologien früh erkennen und deren Entwicklung fördern. Allerdings ist die Früherkennung von Technikentwicklungen alles andere als einfach, und außerdem kann sich die Förderung einer beliebigen Technologie zu einer „sich selbst erfüllenden Vorhersage“ entwickeln.
acatech Präsident Reinhard Ploss ging am 11. Juli in seiner Begrüßung im Deutschen Museum Nürnberg auf die Bedeutung von Vorausschau für die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften ein. Sie sei ein wichtiger Teil des Politikberatungsauftrags von acatech und spiele beispielsweise im Zukunftsrat der Bundesregierung, der inhaltlich von einer bei acatech angesiedelten Geschäftsstelle vorbereitet wird, eine zentrale Rolle. Das Beratungsgremium kam erst kürzlich zu seiner ersten Sitzung im Bundeskanzleramt zusammen.
In der ersten Podiumsdiskussion des Abends diskutierten Armin Grunwald (Karlsruher Institut für Technologie und acatech Präsidiumsmitglied) und Jorg Körner (Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF, Referat 115 – Strategische Vorausschau; Partizipation und Bürgerforschung), welche Relevanz und welche Instrumente der Früherkennung eine vorausschauende Forschungs- und Innovationspolitik auch für die volkswirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit besitzt. Anhand verschiedener Beispiele – von der Nanotechnologie bis zur Endlagerung – zeigte Armin Grunwald auf, welche Zukünfte möglich sind und gab zu bedenken, dass dabei sowohl technologische als auch gesellschaftliche Entwicklungen vorausgedacht werden müssten. Das BMBF suche eine strategische Vorausschau im Zeithorizont von bis zu 15 Jahren, so Jörg Körner. Neben technologischen Entwicklungen werde dabei auch der mögliche oder erwartbare Wertewandel in der Gesellschaft berücksichtigt.
Reinhard Ploss und Diane Robers (Hanns-Seidel-Stiftung, Leiterin der Akademie für Politik und Zeitgeschehen) stellten in der anschließenden Diskussionsrunde heraus, welchen Nutzen Früherkennung zur Sicherung von Technologievorteilen und Souveränität hat. In diesem Zusammenhang berichtete Reinhard Ploss aus seiner Zeit als Vorsitzender des Vorstands der Infineon Technologies AG: In der Halbleiterbranche herrsche bekanntermaßen eine besonders hohe Innovationsgeschwindigkeit, Technologiegenerationen würden bereits nach wenigen Jahren abgelöst durch neue.
Wie hängen Früherkennung und Technikgestaltung zusammen? Wie kann Technikentwicklung an Transparenz gewinnen? Und wie können Techniktrends den Weg ins Museum finden, um dort eine Diskussion über mögliche Entwicklungen anzustoßen? Solche Fragen sind für Museumsleiterin Marion Grether ständige Begleiter: Sie betreibt Trendanalysen entlang von fünf Themenfeldern, reflektiert über Ziele und Zielgruppen des Museums und prüft schließlich die kuratorische Eignung passender Themen und Objekte – wobei es sich bei „Zukunfts-Objekten“ meiste um Prototypen handelt.
Wie die Technik der Zukunft aussieht, konnte am 11. Juli in Nürnberg nicht geklärt werden. Aber alle Beteiligten waren sich einig: Die Offenheit für Technik ist eine notwendige Voraussetzung für die gemeinsame Gestaltung der Zukunft.