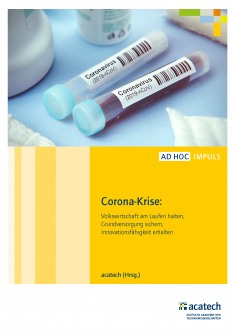„Wir müssen in einen Zustand wachsamer Normalität kommen“: Interview mit Christoph M. Schmidt

München, 7. April 2020
Christoph M. Schmidt ist Präsident des RWI – Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung und acatech Präsidiumsmitglied. Als einer der Hauptautoren des acatech Impulses „Corona-Krise: Volkswirtschaft am Laufen halten, Grundversorgung sichern, Innovationsfähigkeit erhalten“ fordert er für die kommenden Monate einen „Zustand der wachsamen Normalität“. Interview: Marieke Schmidt
Herr Schmidt, Deutschland diskutiert, wie wir aus dem Corona-Shutdown herauskommen. Welche Exitstrategie empfehlen Sie?
Wir sollten uns nicht an der Frage verhaken, ob wir nach Ostern in die Normalität zurückkehren. Aktuell sind die Einschränkungen unserer Kontakte und Mobilität alternativlos. Aber wir müssen in den kommenden Wochen und Monaten einen Prozess der wachsamen Normalisierung durchlaufen. Der Schlüssel dafür liegt in der Ausweitung der Testkapazitäten auf das Corona-Virus, der Einführung von immunologischen Tests und schließlich der Entwicklung eines Impfstoffs. Das sind Grundvoraussetzungen, um die quasi-Quarantäne der gesamten Bevölkerung vorsichtig durch individuelle Schutzmaßnahmen zu ersetzen. Wir können dann schrittweise Bereiche des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens reaktivieren – immer unter der Voraussetzung, dass die Infektionsrate beherrschbar bleibt. Aber auch langfristig können wir nicht einfach in den Zustand vor Corona zurückkehren. Unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft müssen in Zukunft resilienter auf Krisen reagieren können. Auch das verstehe ich unter wachsamer Normalität.
Sie haben eine acatech Ad hoc-Arbeitsgruppe zu Corona geleitet. Wie kommen wir jetzt möglichst gut durch die Krise?
Wir müssen zwei Krisen gleichzeitig bewältigen: die Gesundheitskrise und die Wirtschaftskrise, die aus den zur Eindämmung von COVID-19 notwendigen Beschränkungen resultiert. Im Krisenmanagement brauchen wir drei parallele Handlungsstränge: Wir sollten intervenieren, stabilisieren und stimulieren. An erster Stelle steht die unmittelbare Krisenintervention. Das Gesundheitssystem muss gestärkt werden, die wirtschaftliche Durststrecke überbrückt, und unternehmerische Potenziale müssen mobilisiert werden. Außerdem müssen wir die Folgen eines möglicherweise länger anhaltenden Herunterfahrens der wirtschaftlichen Aktivitäten genau beobachten. Parallel zur Intervention müssen wir stabilisieren. Wir müssen also versorgungsrelevante Wirtschaftsbereiche stützen und besonders gefährdete Arbeitsplätze schützen. Darüber hinaus sollten wir schon heute Stimuli für die Zeit „nach Corona“ vorbereiten, um die Volkswirtschaft möglichst schnell aus dem Krisenmodus wieder in einen nachhaltigen Wachstumsmodus zu bringen.
Der Staat muss mit Stützungsmaßnahmen intervenieren
Schauen wir uns zunächst mal den ersten Bereich näher an, also die kurzfristige Intervention. Wie sehen konkrete Maßnahmen aus?
Intervenieren meint vor allem die Gesundheitsversorgung für den gegenwärtigen Krisenfall zu ertüchtigen. Deutschland hat die Zahl der Intensivbetten und Beatmungsgeräte rasch erhöht, eine beachtliche Leistung. Nun müssen wir die Zahl der Neuinfektionen so weit wie möglich drücken, damit die Behandlungsmöglichkeiten ausreichen. Reserven an Beatmungsgeräten und weiterem Material wie Schutzkleidung müssen aktiviert werden, und wir müssen uns auch mal trauen, die Bürokratie auszusetzen – etwa wenn es darum geht, Notreserven für die Patientenversorgung aufzustellen. Darüber hinaus brauchen Krankenhäuser Liquiditätshilfen, wir benötigen Transparenz über lokale Ressourcen. Auch muss sichergestellt werden, dass es infolge der Priorisierung von Corona-Erkrankten keine Kollateralschäden bei der Krankenversorgung gibt, dass also die Versorgung von Patientinnen und Patienten in anderen Bereichen so gut wie möglich aufrechterhalten wird. Wir können ja dieser Tage beobachten, dass hier bereits einiges unternommen und auf den Weg gebracht wird. Ähnlich sieht es auch mit Blick auf die Volkswirtschaft aus. Auch hier rollen die ersten konkreten Maßnahmen an.
Was muss der Staat tun, um die Volkswirtschaft am Laufen zu halten?
Der Staat muss mit erheblichen Stützungsmaßnahmen intervenieren, hat das erkannt und handelt auch. Sie folgt beispielsweise mit ihren umfangreichen wirtschaftspolitischen Maßnahmenpaketen dem Prinzip „Liquidität geht vor Rentabilität“. Hierfür wurde ein Nachtragshaushalt mit einem Umfang von 122,5 Mrd. Euro verabschiedet. Darin enthalten sind Hilfen für Solo-Selbständige und Kleinstbetriebe, wobei die Leistungen des Bundes aus den Haushalten der Länder ergänzt werden. Jetzt müssen diese Hilfen noch schnell dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Dass mittlerweile auch Startups in der Unterstützung berücksichtigt werden, ist langfristig besonders wichtig und war eines unserer Kernanliegen.
Technologien unterstützen in Medizin und Verwaltung
Wie können Technologien helfen?
Heiß diskutiert wird aktuell ja besonders eine freiwillige Tracing-App, die uns nach Kontakten mit Infizierten warnen sollen. Es gibt aber auch andere Beispiele: Künstliche Intelligenz kommt bei der Entwicklung von Impfstoffen gegen den Corona-Virus Sars-CoV-2, bei der Entwicklung von Wirkstoffen gegen Covid-19 und zur Vorhersage der Verbreitung des Virus in der Bevölkerung zum Einsatz. KI wird außerdem zur Unterstützung der Notfallversorgung oder bei Bilderkennungsverfahren zur besseren Diagnose eingesetzt. Genauso wie bei der Koordination der öffentlichen Verwaltung.
Selbstlernende Systeme auf Basis künstlicher Intelligenz können die Priorisierung medizinischer Hilfeleistung insbesondere bei hohem Patientenaufkommen unterstützen. Ein Beispiel der Charité Berlin und der Plattform Lernende Systeme zeigt, dass diese Systeme dabei helfen, die Patientinnen und Patienten besser durch das Krankenhaus zu lenken – von der Ankunft bis hin zur Behandlung. Außerdem können sie das medizinische Fachpersonal schon frühzeitig bei der Behandlung unterstützen. Zum Beispiel durch die Auswertung von Daten, die Patientinnen und Patienten bereits im Wartebereich selbst erfassen können. Das System ergänzt diese Daten noch um Befunde aus Voruntersuchungen. Damit das klappt, braucht es verlässliche, aktuelle Daten aus elektronischen Gesundheitsakten und auf Daten aus Forschungs- und klinischen Plattformen. Das alles geht natürlich nicht ohne eine vertrauenswürdige digitale Infrastruktur.
Ihre Arbeitsgruppe bei acatech fordert ein Monitoring versorgungsrelevanter Bereiche? Schlittern wir denn auf eine Versorgungskrise zu?
Derzeit zeichnen sich keine grundsätzlichen Beeinträchtigungen der Grundversorgung in Deutschland ab. Engpässe gibt es aber schon im Gesundheitsbereich. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass wir diese Engpässe überwinden. Und wir müssen dafür sorgen, dass sie in anderen Bereichen gar nicht erst entstehen. Beispielsweise sehen wir derzeit keine bedrohlichen Engpässe in der Lebensmittelversorgung, weil Deutschland bei den Grundnahrungsmitteln mehr produziert, als wir konsumieren. Allerdings können bei einigen Früchten und Gemüsesorten Engpässe entstehen, weil wir hier von Importen abhängig sind. Deutschland importiert viele für die Grundversorgung notwendigen Güter, wie Lebensmittel, Energierohstoffe oder Bedarfe für den Gesundheitsbereich. Daher ist es ja auch wichtig, dass die Grenzen für den Warenverkehr offen bleiben und dass wir auch die internationale Entwicklung im Zuge der Pandemiebekämpfung im Blick halten. Für die Versorgung ist es zudem wichtig, dass die Grenzen auch für Arbeitskräfte geöffnet bleiben, die etwa in der Landwirtschaft dringend gebraucht werden.
Ein Krisenstab im Kanzleramt
Wie hält man derart komplexe Entwicklungen im Blick?
Verlässliche Prognosen und Szenarien, wie es in Bereichen wie Landwirtschaft, Ernährung, Gesundheit oder Energieversorgung weitergeht, lassen sich aus heutiger Sicht nicht treffen. Jedes einzelne Wertschöpfungssystem ist komplex. Umso wichtiger ist ein engmaschiges zentrales Monitoring jedes einzelnen Bereichs. Eine Aufgabe, die ein Krisenstab übernehmen sollte, den man meiner Meinung nach im Kanzleramt ansiedeln sollte.
Wäre das die einzige Aufgabe eines solchen Krisenstabs im Kanzleramt?
Wir haben in Deutschland keine Erfahrung mit einer Krise, wie wir sie jetzt erleben. Das Herunterfahren gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Aktivitäten und der Weg heraus sind in unserer Geschichte beispiellos. Wir alle müssen uns daher klar machen, dass Krisenwirtschaft ein lernendes System sein muss. Es gibt keinen Masterplan. Wir bekommen fast täglich neue Infos – etwa zur Letalität des Virus oder zum Fortschritt bei der Entwicklung von Impfstoffen oder Tests, die in politische Entscheidungen einbezogen werden müssen. Entsprechend müssen wir einzelne Bereiche beobachten und auf aktuelle Entwicklungen schnell reagieren.
Wir werden uns für mindestens ein bis eineinhalb Jahre im Modus der Krisenwirtschaft befinden. Für diesen Zeitraum sollte der erwähnte Krisenstab entsprechend eingerichtet werden. Das Monitoring versorgungsrelevanter Bereiche wäre dann eine seiner zentralen Aufgaben. Des Weiteren wäre er dafür zuständig, Strategien aus unterschiedlichen Ministerien und von unterschiedlichen Expertinnen und Experten zusammenzuführen. Ein Beispiel, dass ich vorhin schonmal kurz angerissen habe: Es ist richtig und wichtig, Hilfen für Soloselbstständige oder Kleinstbetriebe in Aussicht zu stellen. Mindestens genauso wichtig ist es aber auch, dass diese zügig bei den Menschen ankommen. Auch hier könnte der Krisenstab koordinieren.
Die Weichen richtig Stellen für die Zeit nach der Krise
Dann fehlt uns nun noch der dritte Bereich, den Sie anfangs mit „stimulieren“ überschrieben haben…
Wir müssen trotz – oder gerade in – der Krise auch an die Zukunft denken und nach Möglichkeit beherzt weiter investieren. Denn auch wenn sich aktuell zurecht alles um das Verhindern dramatischer Versorgungskrisen dreht: Wir können jetzt schon die Weichen so stellen, dass uns keine zukunftsrelevanten Errungenschaften wegbrechen, die uns dann in den kommenden Jahrzehnten fehlen würden.
Können Sie Beispiele nennen?
Nehmen Sie innovative Startups. Diese sind besonders gefährdet, weil sie nicht die Strukturen und Rücklagen haben, eine lange Krise zu überbrücken. Gerade diese zarten Pflänzchen müssen wir jetzt besonders schützen, damit sie nach der Krise weiter wachsen können. Ich denke hier etwa an kreative Köpfe aus den Bereichen der Medizin oder der künstlichen Intelligenz. Wir sprechen dabei über junge und damit noch verletzliche Strukturen, die sich aktuell in der Wachstumsphase befinden. Sie dürfen jetzt nicht wegbrechen oder ins Ausland abwandern. Umso glücklicher bin ich über die Nachricht, dass Finanzminister Scholz nun auch hier Unterstützung zugesagt hat.
Oder nehmen Sie den Klimaschutz. Man hört ja teilweise Stimmen, dass doch die Corona-Krise ein gutes Jahr für den Klimaschutz bringt, weil wir weniger unterwegs sind und auch die Industrieemissionen sinken. Das ist kurzfristig gedacht! Mittel für langfristige Investitionen werden knapp, was den Klimaschutz massiv bremsen kann. Doch Klimaschutz ist die beste Prävention gegen mögliche klimabedingte Krisen. Deshalb wird ein marktwirtschaftliches Signal für den Klimaschutz, wird also der CO2-Preis über die Energiesektoren Strom, Wärme, Verkehr, Industrie hinweg noch wichtiger.
Zu guter Letzt sollten wir aus unserer Not eine Tugend machen und in qualitative Sprünge investieren – zum Beispiel beim E-Learning oder der technischen Ausstattung für mobiles Arbeiten. Die Produktivitätsschübe, die diese Investitionen auslösen, wirken weit über die gegenwärtige Krise hinaus.
International denken und handeln
Befördert die gegenwärtige Krise nationalstaatliches Denken und Handeln?
Grenzschließungen helfen nicht bei der Pandemiebekämpfung, bringen aber massive Probleme in Logistik und Versorgung. Nationalstaatliche Reflexe und populistische Antworten verschärfen deshalb die Krise. Es ist eine weltweite Pandemie und wir müssen auch europäische und globale Antworten finden. Das gilt nicht nur für die Corona-Pandemie, sondern auch, wenn es anschließend heißt, aus der Krise zu lernen und sich für die Zukunft zu wappnen. Die Welt ist zusammengewachsen: Gesundheit, Verhinderung von Pandemien, Klimaschutz, Wohlstand, all das sind gemeinsame Aufgaben aller Länder. Deutschland und Europa müssen Teil oder sogar treibende Kraft bei der Entwicklung von Lösungen für all diese Gemeinschaftsaufgaben sein.
Was halten Sie in diesem Zusammenhang von finanziellen Hilfen für unsere europäischen Nachbarländer, die dieser Tage heiß diskutiert werden?
Meine Einschätzung dazu: Wir haben ein Problem, das auch europäische Lösungen verlangt und wir sollten die europäische Solidarität stärken. So brauchen wir etwa einen gemeinsamen Pandemieplan, der unter anderem beinhalten sollte, wie wir innerhalb Europas den Aufbau von Reservekapazitäten regeln oder wie wir an ausreichend Schutzmasken und Desinfektionsmittel gelangen. Bezugnehmend auf finanzielle Fragen dürfen wir nicht vergessen, dass wir funktionierende Strukturen innerhalb der EU eingerichtet haben, die auch in diesem Fall greifen: Damit die Zinsen für höher verschuldete Länder in der Phase des Krisenmanagements nicht zu stark ansteigen, können wir Kredite innerhalb des Europäischen Schutzmechanismus ESM absichern lassen.
Aber wir sollten auch über die europäischen Grenzen hinausschauen. Deutschland und Europa müssen jetzt auch ärmeren Ländern beistehen – großzügig, schnell und effektiv. Ich denke hier zum Beispiel an Indien oder afrikanische Länder. Dort sollten wir mit Geld, Technologie, Knowhow und praktischer Hilfe vor Ort so gut wie möglich unterstützen. Wir erhalten bei acatech gute Ideen aus der Forschung, wie Deutschland diese Länder beim dringenden Aufbau von medizintechnischen Kapazitäten unterstützen könnte.
Ein detailliertes Monitoring
Wie lange können wir die gegenwärtigen Einschränkungen wirtschaftlich durchhalten?
Wir haben kaum Erfahrung mit dem gezielten Herunter- und wieder Herauffahren einer hochgradig arbeitsteiligen und vernetzten Wirtschaft. Was wir sagen können, ist, dass sich die wirtschaftspolitischen Überbrückungsmaßnahmen des aktuellen Shutdowns nicht unbegrenzt durchhalten lassen. Umgekehrt ist auch ein Ausstieg aus dem Shutdown nur durchzuhalten, wenn eine explodierende Anzahl von Neuinfektionen vermieden wird. Weder ethisch noch wirtschaftlich ist also ein verfrühtes Aufweichen der Schutzmaßnahmen denkbar.
Wo genau Kipppunkte liegen, ab denen ein geregeltes Hochfahren der Wirtschaft schwerfallen würde, lässt sich nicht zuverlässig vorhersagen. Wir sprechen in diesem Kontext immer nur über Was-wäre-wenn-Rechnungen, in denen schon kleinste Änderungen an Zahlen oder Maßnahmen große Auswirkungen haben. Wenn unsere hochkomplexe Volkswirtschaft an einer empfindlichen Stelle gestört wird, die wir vorher nicht betrachtet haben, kann eine ganze Produktions- und Lieferkette ins Straucheln geraten. Daher unser Appel, alle versorgungsrelevanten Wirtschaftsbereiche detailliert zu monitoren. Da sind wir erneut bei der Einrichtung eines Krisenstabs, der das zentral bündelt und weiterträgt.
Wie kommen wir dann aus der jetzigen Situation heraus?
Mittelfristig führt kein Weg an flächendeckenden Tests und einer individuellen Isolierung von Infizierten und Kontaktpersonen vorbei. Derzeit befinden sich mehrere immunologische Tests in Erprobung, die innerhalb der kommenden Wochen verfügbar werden könnten. Sie ermöglichen es, Menschen zu identifizieren, die bereits eine schleichende Infektion hinter sich haben, somit auf absehbare Zeit immun sind und deshalb wieder ihren Tätigkeiten nachgehen können. Die Behandlung gefährdeter Bevölkerungsteile ließe sich priorisieren. Ebenso könnte der Gefährdungsgrad nach Lockerung des Social Distancing epidemiologisch erfasst werden. Die Bereitstellung solcher Tests sollte maximal unterstützt werden.
In der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften beschäftige ich mich mit weiteren Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft aktuell intensiv mit der Krisensituation. In den kommenden Wochen werden wir dann weitere Vorschläge in die Diskussion einbringen, wie wir in der aktuellen Situation bestmöglich intervenieren aber auch gestalten können.