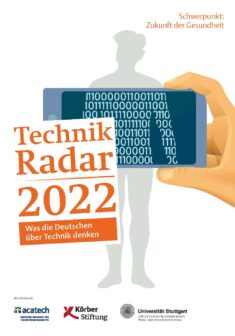Zukunft der digitalisierten Medizin – Tagung mit der Evangelischen Akademie in Tutzing

Tutzing, 10. November 2022
Die elektronische Patientenakte (ePA) ist ein zentraler Baustein für die Digitalisierung des deutschen Gesundheitssystems. Behandelnde Ärztinnen und Ärzte, Patientinnen und Patienten sowie Forschungsinstitute sollen den umfangreichen Datenschatz gleichberechtigt nutzen können. Doch wie kann eine digitale Transformation der Medizin ihre Potenziale ausschöpfen, wenn viele Menschen zögern, ihre Gesundheitsdaten zur Verfügung zu stellen und die ePA zu nutzen? Darüber sprachen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf der gemeinsamen Tagung „Zukunft der digitalisierten Medizin“ von acatech und dem Institut Technik-Theologie-Naturwissenschaften der LMU München (TTN) sowie der Evangelischen Akademie am 24./25. Oktober in Tutzing.
Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen in der Medizin
 acatech Mitglied Olaf Dössel (Institut für Biomedizinische Technik, Karlsruher Institut für Technologie) nutzte den Einstieg in die Tagung, um zunächst zu verdeutlichen, welche vielfältigen Arten an digitalen Gesundheitsdaten anfallen: von medizinischen Bildern und Messsignalen über Medikation bis hin zu Daten, die aus Gesundheits-Apps oder der Qualitätssicherung in der Medizin stammen. Aktuell sei das Zusammenführen dieser unterschiedlichen Daten größtenteils untersagt, lediglich in anonymisierter Form sei ihre Nutzung zu Forschungszwecken möglich. Durch Einführung der ePA gelange das Datenmanagement in Patientenhand. Diese könnten nun individuell die Freigabe ihrer Gesundheitsdaten regeln.
acatech Mitglied Olaf Dössel (Institut für Biomedizinische Technik, Karlsruher Institut für Technologie) nutzte den Einstieg in die Tagung, um zunächst zu verdeutlichen, welche vielfältigen Arten an digitalen Gesundheitsdaten anfallen: von medizinischen Bildern und Messsignalen über Medikation bis hin zu Daten, die aus Gesundheits-Apps oder der Qualitätssicherung in der Medizin stammen. Aktuell sei das Zusammenführen dieser unterschiedlichen Daten größtenteils untersagt, lediglich in anonymisierter Form sei ihre Nutzung zu Forschungszwecken möglich. Durch Einführung der ePA gelange das Datenmanagement in Patientenhand. Diese könnten nun individuell die Freigabe ihrer Gesundheitsdaten regeln.
Diese neuen Perspektiven waren unter anderem ein Aufhänger der anschließenden Diskussion. „Datenspende“ kann die Forschung in vielen Bereichen voranbringen, wobei die Möglichkeiten von „broad consent“ (einer allgemeinen Freigabe der persönlichen Gesundheitsdaten) im Gegensatz zu „granularer Freigabe“ (einer Einzelfall-spezifischen Freigabe) erörtert, aber auch die Gefahren eines willkürlichen Datenmanagements gesehen wurden.
Weiterhin zeigte Olaf Dössel am Beispiel des Mammographie-Screenings auf, welche neuen Möglichkeiten es dank des Einsatzes von Maschinellem Lernen im Bereich Befundung gibt. Das dort bisher gesetzlich vorgeschriebene „double reading“-Verfahren, bei dem die Befundung durch zwei Ärztinnen bzw. Ärzte erfolgen muss, könne zukünftig durch das „single reading“ einer Ärztin/eines Arztes in Kombination mit Computer-assistierter Detektion/Diagnose (CAD) ersetzt werden. So könne dieselbe Sicherheit der Befundung gewährleistet werden, bei gleichzeitig reduziertem Personalbedarf – auch hinsichtlich des sich ankündigenden Ärztemangels eine vielversprechende Aussicht.
Welche neuen Möglichkeiten ergeben sich durch die Anwendung von Maschinellem Lernen für Diagnose und Therapie?
Diagnosen und Therapievorschläge werden besser für den individuellen Patienten, da der Arzt / die Ärztin alle gemessenen Daten (medizinische Bilder, Messdaten wie z.B. EKG und Labor-Daten) dabei besser berücksichtigen kann. Aber auch die zukünftige Behandlung aller Patienten kann mit Hilfe von ML verbessert werden – vorausgesetzt viele Patienten spenden ihre Daten für Forschungsprojekte. Wichtig ist, dass die vielfach publizierten ethischen und regulatorischen Randbedingungen so weit wie möglich eingehalten werden.
Olaf Dössel, Institut für Biomedizinische Technik, Karlsruher Institut für Technologie
Chancen der Nutzung von klinischen und präklinischen Forschungsdaten für Prävention und Therapie
 Martin Hrabĕ de Angelis (TU München, Helmholtz Zentrum München) blickte in seinem Beitrag aus Sicht der klinischen und präklinischen Forschung auf die Chancen der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Forschungsprojekte seien insbesondere auf große Mengen qualitativ hochwertiger Daten angewiesen – so wie sie beispielsweise schon jetzt durch die Nutzung von Wearables millionenfach erfasst werden, aber aktuell der öffentlichen Forschung nicht zur Verfügung stehen. Dass eine sparsame Verwendung dieser Daten möglich sei, zeigte er am Konzept des „Swarm Learnings“: eine Vorgehensweise, bei der keine zentrale Datenspeicherung erforderlich sei. Stattdessen werden dezentral erforderliche Parameter generiert, welche anschließend ausgetauscht werden – ohne Rückschluss auf die dahinterstehende Person. Er plädierte für eine Weiterentwicklung und Bündelung von Initiativen zur Verbesserung des Datenzugangs, um einer Vielzahl an Forschenden Zugang zu den Daten zu gewährleisten. Dies könne dadurch ergänzt werden, dass eine neue Kultur des Datenteilens gefördert würde.
Martin Hrabĕ de Angelis (TU München, Helmholtz Zentrum München) blickte in seinem Beitrag aus Sicht der klinischen und präklinischen Forschung auf die Chancen der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Forschungsprojekte seien insbesondere auf große Mengen qualitativ hochwertiger Daten angewiesen – so wie sie beispielsweise schon jetzt durch die Nutzung von Wearables millionenfach erfasst werden, aber aktuell der öffentlichen Forschung nicht zur Verfügung stehen. Dass eine sparsame Verwendung dieser Daten möglich sei, zeigte er am Konzept des „Swarm Learnings“: eine Vorgehensweise, bei der keine zentrale Datenspeicherung erforderlich sei. Stattdessen werden dezentral erforderliche Parameter generiert, welche anschließend ausgetauscht werden – ohne Rückschluss auf die dahinterstehende Person. Er plädierte für eine Weiterentwicklung und Bündelung von Initiativen zur Verbesserung des Datenzugangs, um einer Vielzahl an Forschenden Zugang zu den Daten zu gewährleisten. Dies könne dadurch ergänzt werden, dass eine neue Kultur des Datenteilens gefördert würde.
Medizin-Daten erheben, nutzen und schützen

Matthias Baumhauer (mint medical GmbH) ging zu Beginn seines Vortrags auf die Schwierigkeiten ein, die mit abweichenden Interpretationen während radiologischer Befundung einhergehen. Begriffe wie „Diagnostik von“, „Beweis für“ oder „unwahrscheinlich“ sind nur eine Auswahl der Begriffe, die uns im Allgemeinen eindeutig erscheinen, aber die laut einer Umfrage unter Ärztinnen und Ärzten unterschiedlich verwendet werden. Um daraus resultierende Fehlbehandlungen zu vermeiden, zeigte er auf, welche Vorteile in prozessorientierter, strukturierter Befundung liegen. Eingesetzte Assistenzsysteme sollen, selbst wenn sie ohne Künstliche Intelligenz auskommen, die Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit der Befunde garantieren. Weiter zeigte Matthias Baumhauer auf, dass die Befundungs-Entscheidung aus unterschiedlich komplexen Einzelentscheidungen bestehe. Hier machte er deutlich, dass sich der Einsatz von Maschinellem Lernen nicht für alle Arbeitsbereiche des ärztlichen Alltags gleich gut eigne, sondern vielmehr ein Weg geschaffen werden müsse, die ärztliche Expertise vielfältig zu ergänzen.
Wie ermöglicht die von Ihnen entwickelte Plattform (mint Lesion) die standardisierte Auswertung radiologischer Befunde, um deren Ergebnisse für die wissenschaftliche Erforschung sowie die Patientenversorgung datenschutzkonform zu verwenden?
mint Lesion bietet eine leistungsstarke und skalierbare Infrastruktur, die den einschlägigen Data-Governance-Standards und den Datenschutzbestimmungen gerecht wird. Die Plattform unterstützt die Nutzer bei der Extraktion, Aggregation und Auswertung strukturierter, hochwertiger Daten aus radiologischen Bildern.
Matthias Baumhauer, mint medical GmbH
Telemedizin und Arzt-Patienten-Verhältnis
Wie ändert sich das Arzt-Patienten-Verhältnis durch die weitere Verbreitung telemedizinischer Anwendungen?
Die Digitalisierung im Gesundheitsmarkt wird durch die einhergehende Effizienzsteigerung vielen Menschen ein gesünderes und sicheres Leben ermöglichen und dem Ärztemangel entgegenwirken. Durch den zunehmend gesteigerten Einsatz von digitaler Technik wird daher meiner Meinung nach die persönliche Beziehung zwischen Arzt und Patienten intensiviert werden. Denn es verbleibt mehr Zeit für die sprechende und erklärende Medizin, wenn beispielsweise repetitive Aufgaben wie Dokumentation und Abrechnung automatisiert werden.
Reinhard Meier, Zentrum für Radiologie des Westpfalz-Klinikums in Kaiserslautern
Digitalisierte Medizin aus Sicht der Deutschen – das TechnikRadar 2022 zur Zukunft der Gesundheit
Cordula Kropp (ZIRIUS, Universität Stuttgart) stellte die Ergebnisse des TechnikRadar 2022 „Zukunft der Gesundheit“ vor. Die Studie belege einerseits eine allgemeine Offenheit der Gesellschaft gegenüber der Digitalisierung (auch im Gesundheitswesen), zeige jedoch gleichzeitig auch die deutlichen Unterschiede in der Bereitschaft der Bevölkerung, diese digitalen Gesundheitsangebote zu nutzen. Diese Bereitschaft hänge mit dem Alter, Geschlecht bzw. Lebensstil der Befragten zusammen.

Georg Münzenrieder, Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege (StMGP), verwies in seinem anschließenden Kommentar auf bereits laufende Maßnahmen im Gesundheitssystem. Er hob dabei hervor, wie wichtig eine umfangreiche, begleitende Kommunikationsstrategie sei, um Akzeptanz zu schaffen und bekannte, dass er große Hoffnungen mit der gerade laufenden Digitalisierungsstrategie des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) verknüpfe.
Telemedizin in der Kardiologie
 Carsten Lennerz (Deutsches Herzzentrum München) sprach in seinem Vortrag über das Telemonitoring bei kardiologischen Patientinnen und Patienten und die Möglichkeit der engmaschigen Fernüberwachung klinischer und technischer Patientendaten. Telemonitoring ermöglicht es, wichtige Gesundheitswerte, wie zum Beispiel Blutdruck oder Puls, aus der Ferne zu überwachen und gegebenenfalls schnell zu reagieren. Die Technik kann dazu beitragen, chronisch Kranke besser zu behandeln, aber auch zur Vorbeugung und als Begleitung einer Therapie eingesetzt werden. Möglich ist das Telemonitoring durch externe Sensoren oder Patienten-Wearables (wie zum Beispiel EKG-Geräte, die wie eine Armbanduhr am Handgelenk getragen werden), aber auch durch implantierbare Sensoren und Therapiegeräte. Durch Implantate könne laut Studien beispielsweise bei dreimal mehr Patientinnen und Patienten Vorhofflimmern diagnostiziert werden und so bei 20-30 Prozent aller Schlaganfälle präventiv eingegriffen werden, sagte Carsten Lennerz. Verhindern könne man einen Schlaganfall dadurch trotzdem nicht. Dennoch kämen telemedizinische Angebote der Denkweise der nächsten Patientengeneration entgegen, da diese bereits einen zunehmend digitalisierten Alltag erlebe und eine höhere Bereitschaft für die vielfältigen Monitoring-Felder aufweise.
Carsten Lennerz (Deutsches Herzzentrum München) sprach in seinem Vortrag über das Telemonitoring bei kardiologischen Patientinnen und Patienten und die Möglichkeit der engmaschigen Fernüberwachung klinischer und technischer Patientendaten. Telemonitoring ermöglicht es, wichtige Gesundheitswerte, wie zum Beispiel Blutdruck oder Puls, aus der Ferne zu überwachen und gegebenenfalls schnell zu reagieren. Die Technik kann dazu beitragen, chronisch Kranke besser zu behandeln, aber auch zur Vorbeugung und als Begleitung einer Therapie eingesetzt werden. Möglich ist das Telemonitoring durch externe Sensoren oder Patienten-Wearables (wie zum Beispiel EKG-Geräte, die wie eine Armbanduhr am Handgelenk getragen werden), aber auch durch implantierbare Sensoren und Therapiegeräte. Durch Implantate könne laut Studien beispielsweise bei dreimal mehr Patientinnen und Patienten Vorhofflimmern diagnostiziert werden und so bei 20-30 Prozent aller Schlaganfälle präventiv eingegriffen werden, sagte Carsten Lennerz. Verhindern könne man einen Schlaganfall dadurch trotzdem nicht. Dennoch kämen telemedizinische Angebote der Denkweise der nächsten Patientengeneration entgegen, da diese bereits einen zunehmend digitalisierten Alltag erlebe und eine höhere Bereitschaft für die vielfältigen Monitoring-Felder aufweise.
Entscheidungen in der digitalen Patientenversorgung aus der Perspektive der Ethik
Was ist für Sie aus ethischer Sicht die größte Herausforderung der digitalisierten Medizin?
Die Herausforderung ist über die Nutzen-Risiko-
Analyse hinauszugehen und die Veränderungen durch Digitalisierung zum Beispiel in der Kommunikation
zwischen Arzt und Patient parallel zu diskutieren,
um das Vertrauen in gute Versorgung zu erhalten.
Julia Inthorn, Zentrum für Gesundheitsethik an der Evangelischen Akademie Loccum, Hannover
 Bianca Jansky (Universität Augsburg) berichtete in ihrem Beitrag über das META-Projekt der Universität Augsburg und über eine im Rahmen des Projekts durchgeführte empirische Studie. Im Rahmen dieser Studie wurden Interviews in den USA, Indien und Deutschland gemacht, die sich mit der Forschungsfrage: „Welche Werte, Normen und Moralvorstellungen leiten Stakeholder in der Health-App-Entwicklung?“ beschäftigen. Eine Erkenntnis, die Sie bei der Auswertung der Interviews gewann sei, dass die in den USA Befragten sich in ihren Antworten sehr universell auf die ganze Welt übertragend äußerten, im Gegensatz dazu waren die Antworten aus Indien sehr auf das eigene Land bezogen.
Bianca Jansky (Universität Augsburg) berichtete in ihrem Beitrag über das META-Projekt der Universität Augsburg und über eine im Rahmen des Projekts durchgeführte empirische Studie. Im Rahmen dieser Studie wurden Interviews in den USA, Indien und Deutschland gemacht, die sich mit der Forschungsfrage: „Welche Werte, Normen und Moralvorstellungen leiten Stakeholder in der Health-App-Entwicklung?“ beschäftigen. Eine Erkenntnis, die Sie bei der Auswertung der Interviews gewann sei, dass die in den USA Befragten sich in ihren Antworten sehr universell auf die ganze Welt übertragend äußerten, im Gegensatz dazu waren die Antworten aus Indien sehr auf das eigene Land bezogen.

Stephan Schleissing (TTN) schloss die Tagung und fasste in seiner Verabschiedung die Chancen der Digitalisierung im Gesundheitswesen unter anderem als Möglichkeit für Bürgerinnen und Bürger ihre eigenen Gesundheitskompetenzen zu stärken zusammen: Einerseits, indem medizinische Sensoren, Wearables, Gesundheits- und Fitness-Apps weitere Verbreitung finden, andererseits dadurch, dass sie als Patientinnen und Patienten verstärkt in die digitalisierte Verwaltung ihrer Gesundheitsdaten eingreifen können.
Die Tagung fand statt im Rahmen der Reihe „Innovation und Verantwortung“. Bereits zum elften Mal wurden die unterschiedlichen Wissenskulturen der Technikwissenschaften und der Theologie zusammengebracht und dabei Ansätze zum verantwortungsvollen Umgang mit technischen Innovationen diskutiert. Den interdisziplinären Dialog moderierten Stephan Schleissig (TTN) und Marc-Denis Weitze (acatech Geschäftsstelle).