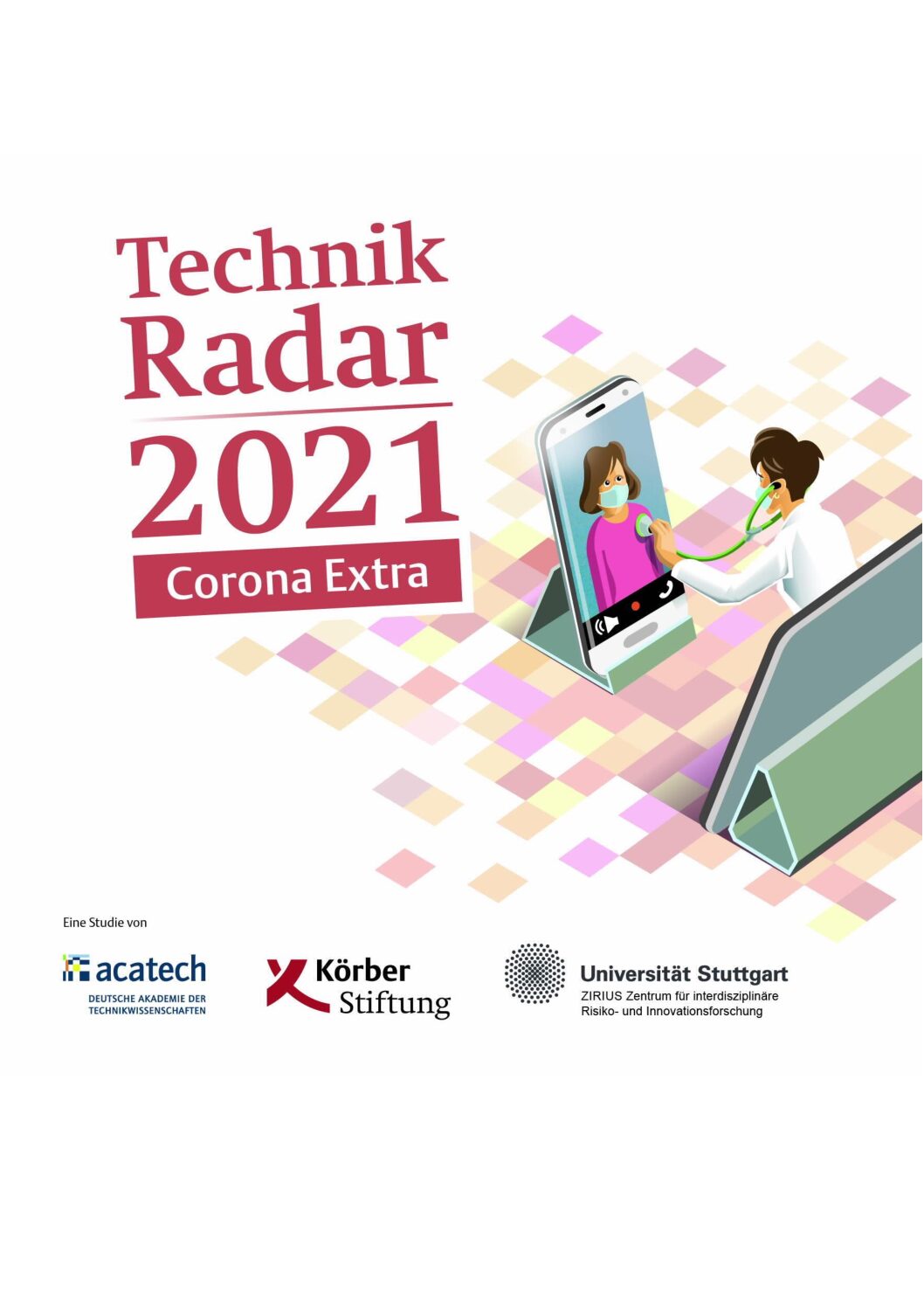TechnikRadar

© acatech/Körber-Stiftung
Was ist das TechnikRadar?
Das TechnikRadar umfasst eine regelmäßige Repräsentativbefragung der Bevölkerung zu Einstellungen, Wünschen, Hoffnungen, Befürchtungen und Bedarfen zu neuen Technologien und deren Implikationen. Als langfristig angelegtes Frühwarnsystem macht es Fehlentwicklungen des technologischen Wandels rechtzeitig erkennbar oder weist auf einen besonderen Kommunikationsbedarf hin. Gleichzeitig möchte das TechnikRadar Innovationsprozesse unterstützen, damit Produkte und Technologien im Einklang mit den Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger stehen. Die Ergebnisse bieten eine fundierte Grundlage für die Diskussion um den Stellenwert, die Gestaltungmöglichkeiten und die Regulierungserfordernisse technischer Innovationen.
TechnikRadar 2024 – Trends bei Technikeinstellungen

Das TechnikRadar 2023 mit dem Schwerpunktthema „Trends bei Technikeinstellungen“ wurde am 11.06.2024 veröffentlicht. Was denken die Deutschen über Technik? Erfahren Sie mehr zur Analyse der Ergebnisse seit 2017 im Längsschnitt:
Vergangene Ausgaben
Das TechnikRadar 2023 beschäftigte sich mit dem Schwerpunktthema „Nachhaltiges Bauen und Wohnen“. Wie beurteilen die Deutschen nachhaltiges Bauen und Wohnen, in welchen Bereichen sehen sie die Möglichkeit Energie durch Verhaltensänderung oder neue Geräte zu sparen und wie stehen sie zu Robotern im Bau und Smart City-Anwendungen? Denn, den Deutschen sind die Themen Klimaschutz, erneuerbare Energien und der Einsatz energiesparender Geräte und Sanierungsmöglichkeiten wichtig. Zudem zeigt sich, dass viele selbst zum Handeln bereit sind.
Im Fokus des TechnikRadar 2022 stand die Frage, wie die Deutschen die Möglichkeiten der digitalen Transformation im Gesundheitswesen beurteilen. Ein Teil der Bevölkerung verbindet damit die Hoffnung auf neue Therapien dank eines umfassenden Zugriffs auf medizinische Daten für die Forschung und einer deutlich besseren Gesundheitsversorgung, andere befürchten dagegen, mit der wachsenden Datenflut endgültig zum »gläsernen Patienten« zu werden. Hier finden Sie alle Ergebnisse des TechnikRadar 2022 auf einer Übersichtsseite. Die dem TechnikRadar 2022 zu Grunde liegenden Befragungsdaten können in der Datenbank GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften unter diesem Link abgerufen werden.
Im TechnikRadar 2021 wurden gesundheitsrelevante Stakeholder nach ihrer Bewertung der digitalen Transformation des Gesundheitswesens gefragt. Eine Sonderausgabe der Studie, das TechnikRadar 2021 Corona Extra, ging der Frage nach, wie sich die Einstellungen der Deutschen zu Technik mit den Erfahrungen der Corona-Pandemie verändert haben.
Das TechnikRadar 2020 fragt neben der allgemeinen Einstellung zu Technik ab, wie die Deutschen zu den Zielen und möglichen Auswirkungen der Bioökonomie stehen. Die zugrundeliegenden Daten des TechnikRadar 2020 sind im datorium unter diesem Link abrufbar.
Die Ergebnisse des TechnikRadar 2018 (Schwerpunkt Digitalisierung) wurden im TechnikRadar 2019 mit den Einstellungen der Menschen anderer europäischer Länder verglichen. Der Datensatz, der den beiden Studien von 2018 und 2019 zugrunde liegt, findet sich ebenfalls in der Datenbank von GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, unter diesem Link.
Pressemappen zum TechnikRadar
Mitglieder der Projektgruppe
- Univ.-Prof. Dr. Daniel Barben
Universität Klagenfurt - Prof. Martin W Bauer
London School of Economics and Political Science - Prof. Dr. Manuel Frondel
RWI-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung - Prof. Dr. Martina Heßler
TU Darmstadt - Prof. Dr. Eva-Maria Jakobs
RWTH Aachen University - Prof. Dr. Cordula Kropp
Universität Stuttgart - Prof. Dr. Sabine Maasen
Universität Hamburg - Prof. Dr. Drs. h.c. Ortwin Renn
RIFS - Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit - Prof. Dr. Mike Schäfer
Universität Zürich
Mitglieder des Begleitkreises
- Nicole Burkhardt
Bundesministerium für Bildung und Forschung - Jonathan Diesselhorst
Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt - Dr. Benedikt Fecher
Wissenschaft im Dialog gGmbH - Prof. Dr. Bita Fesidis
VDI - Dr. Saskia Freye
Hans-Böckler-Stiftung - Caroline Gebauer
BUND - Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. - Dr. Markus Ksoll
Deutsche Bahn AG - Dr. Karen Köhler
Bayer AG - Dr. Sicco Lehmann-Brauns
Siemens AG - Dr. Steffi Ober
NABU – Naturschutzbund Deutschland e.V. - PD Dr.-Ing. Simone Raatz
Helmholtz Institut Freiberg für Ressourcentechnologie - Dr. Ulrich Romer
Bundesminsterium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) - Dr. Stephan Schleissing
Institut Technik-Theologie-Naturwissenschaften - Volker Stollorz
Science Media Center Germany gGmbH - Dr. Theresa Züger
Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft