„Industrie 4.0 ist nach wie vor hochaktuell“ – Interview mit Prof. Wolfgang Wahlster zum zehnjährigen Jubiläum von Industrie 4.0
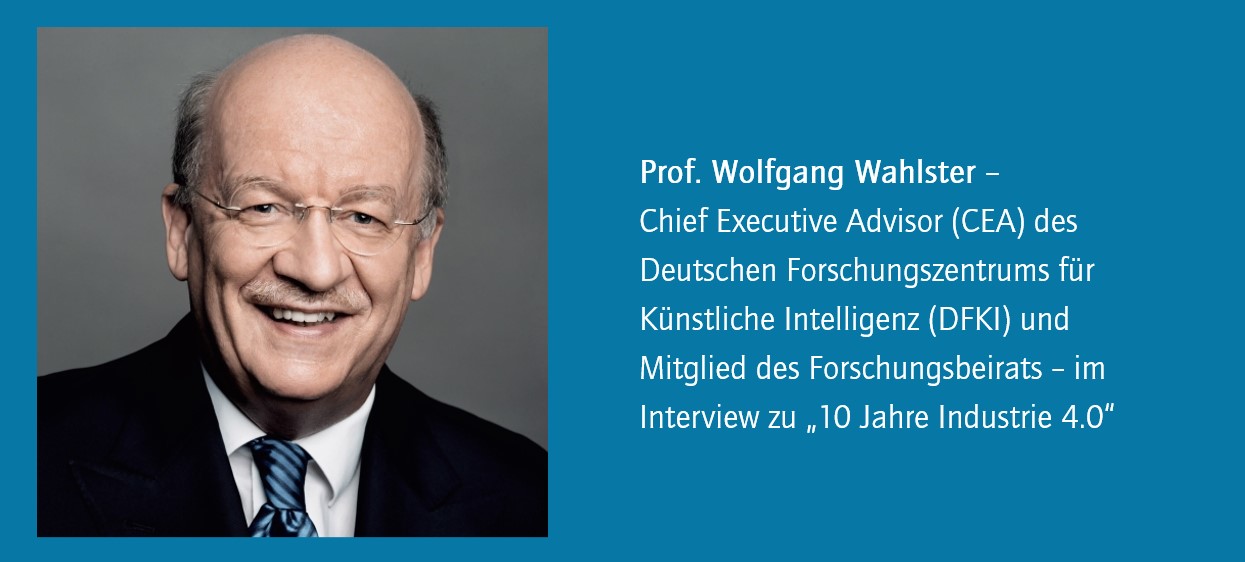
München, 12. April 2021
Prof. Dr. Wolfgang Wahlster ist Mitglied des Forschungsbeirats der Plattform Industrie 4.0 und Chief Executive Advisor (CEA) vom Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI).
Der Begriff Industrie 4.0 wurde erstmals auf der HANNOVER MESSE 2011 öffentlich kommuniziert.
Wie kam es zur Entstehung des Begriffs und welche Personen waren an der Entwicklung von Industrie 4.0 beteiligt?
In der Forschungsunion Wirtschaft-Wissenschaft, die die Hightech-Strategie der Bundesregierung begleitet, existierte eine sogenannte Promotoren-Gruppe für Informations- und Kommunikationstechnologien. Darin waren Henning Kagermann (damals acatech-Präsident), Wolf-Dieter Lukas (BMBF) und ich Mitglied. Wir hatten die Aufgabe, ein sehr ehrgeiziges Projekt zu definieren, das berücksichtigte, dass damals jeder zweite Arbeitsplatz in Deutschland von der industriellen Produktion direkt oder indirekt abhing. Ziel war es, dass Deutschland Leitanbieter im Maschinenbau bleiben sollte. Da zu dieser Zeit gerade cyber-physische Systeme für das Internet der Dinge eine wichtige IT-Entwicklung darstellten, beschlossen wir, cyber-physische Systeme für die Produktion anzuregen. Das war unsere Grundidee. Wir entschieden, dass sich der Begriff „Industrie 4.0“ für unser Vorhaben eignen würde, denn es gab bereits drei industrielle Revolutionen und dies sollte die vierte werden. Das „4.0“ sollte andeuten, dass das Vorhaben sehr stark IT-basiert sein würde. Der Begriff konnte anschließend weltweit ausgerollt werden. Heute ist er ein Begriff mit deutschen Wurzeln wie „Kindergarten“ oder „Autobahn“, international gebräuchlich und akzeptiert. Bei Google findet man aktuell 25 Millionen Hinweise auf Industrie 4.0 und über 100.000 Publikationen. Dass so ein Hightech-Trend nicht aus den USA oder Asien kommt, gab es schon lange nicht mehr. Bei der Eröffnung der Hannover Messe 2011 konnte ich bei meiner Rede zum Hermes Award den Begriff „Industrie 4.0“ zum ersten Mal vor einem großen Publikum erläutern. Bundeskanzlerin Angela Merkel meinte daraufhin zu mir, „Herr Wahlster, das wollen wir jetzt verfolgen, Industrie 4.0, das ist ja genau die Zukunft“. Beim anschließenden Abendempfang war Industrie 4.0 das Thema Nummer eins. Unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Maschinenbau, waren zunächst etwas irritiert, dass dezidierte IT-Fachleute wie Henning Kagermann und ich eine Revolution in der Fertigungstechnik ausriefen. Diese Skepsis ist inzwischen längst verflogen und schlug schon in den ersten beiden Jahren in Begeisterung um.
Wie hat sich der Begriff seit 2011 verändert?
Dass sich ein Begriff ändern kann, haben wir bereits bei der Definition von Industrie 4.0 eingeplant. Daher haben wir neben konkreten technischen Möglichkeiten auch abstrakte Ziele im Konzept formuliert. Die Zielsetzung von Industrie 4.0 ist heute unverändert gültig: Der Mensch steht im Mittelpunkt, außerdem die Ressourcenschonung, also die grüne, die urbane und die wandelbare Produktion. Also die Möglichkeit, die Fabrik immer wieder an neue Produkte ohne aufwändige Umrüstung anzupassen. Auch die Möglichkeiten zur effizienten Produktion kleiner Losgrößen war schon von Anfang an eine zentrale Zielsetzung.
Später sind Aspekte wie beispielsweise die „Null-Fehler-Produktion“ hinzugekommen. Heutige KI-Systeme ermöglichen es, jeden Schritt der Produktion so gut zu überwachen, dass Fehler fortlaufend erkannt werden und nicht erst am Ende, wenn das Produkt schon erstellt ist. Eine weitere neue Entwicklung ist die Möglichkeit, Intralogistik und Produktion so zu koppeln und in Echtzeit zu steuern, dass wir auf kleinste Anomalien sofort reagieren können.
Welche vergangenen Herausforderungen galt es bei der Industrie 4.0-Entwicklung zu überwinden und welche Hindernisse bestehen aktuell?
Am Anfang gab es Missverständnisse: Mancher dachte, dass wir unter Industrie 4.0 nur die Verlegung von Ethernet-Kabeln in der Fabrik verstanden. Das war natürlich nicht der Fall. Wenn Sie Bits und Bytes zwischen Maschinen über einen IP-Standard austauschen, resultiert daraus kein direkter Fortschritt. Die technische Kommunikation allein reicht aber nicht aus, es müssen auch semantische Nachrichten vor dem Hintergrund eines fachlichen Verständnisses der Fertigungsprozesse ausgetauscht werden. Die Maschinen tauschen inzwischen wechselseitig Informationen aus und machen diese im Fabrik-Cockpit für die Menschen, die in der Fabrik tätig sind, transparent. Zukünftig wird die Mensch-Maschine-Interaktion eine noch bedeutendere Rolle einnehmen. Das sehen wir auch in der Robotik: Wir wollen Roboter nicht länger nur ohne Interaktion mit Facharbeitenden isoliert hinter Schutzgittern einsetzen, sondern sie sollen mit dem Menschen Hand in Hand kooperieren.
Wie würden Sie den Fortschritt bei der Implementierung von Industrie 4.0 beschreiben? Können Sie abschätzen, zu welchem Zeitpunkt Industrie 4.0 großflächig z.B. im Produktionsumfeld implementiert sein wird?
Wir haben jetzt die erste Halbzeit nach zehn Jahren abgeschlossen und enorme Fortschritte gemacht. Deutschland hat im Kontext von Industrie 4.0 weltweit einen Vorsprung von ein bis zwei Jahren, obwohl derzeit nicht mehr als 10 % der deutschen Produktion komplett auf Industrie 4.0 umgestellt ist. In vielen Fabriken gibt es aber schon Produktionsinseln, welche die Prinzipien von Industrie 4.0 verfolgen und implementieren, aber noch nicht die gesamte Fabrik. Das liegt auch daran, dass wir natürlich enorm viele Bestandsfabriken haben – diese müssen anhand entsprechender Migrationstechnologien sukzessive umgerüstet werden. Auch die Fachkräfte müssen für Industrie 4.0 geschult werden. Hierbei kommt uns entgegen, dass wir immer mehr Handhelds und Datenuhren auch in der Fabrik einsetzen können. Wearables wie z.B. Datenbrillen ermöglichen ein lebenslanges Lernen direkt am Arbeitsplatz und erleichtern Veränderung von Prozessen. Wir brauchen mindestens noch 10 Jahre, um Industrie 4.0 überall zu realisieren: das wäre dann im Vergleich zu den drei vorangegangenen industriellen Revolutionen sehr schnell.
Welche politischen Stellschrauben sind von der zukünftigen Bundesregierung zu justieren, damit Deutschland auf dem globalen Industrie-4.0-Markt weiterhin seine gute Wettbewerbsposition behält?
Das Allerwichtigste ist: Es muss mit hohem Innovationstempo mit der breiten Umsetzung auch im Mittelstand weitergehen. Wir gehen jetzt in die zweite Halbzeit und die tolle Unterstützung, die wir von der jetzigen Regierung hatten, sollte auch zukünftig fortgeführt werden. Es wäre ein großer Fehler, wenn man mitten in einer solchen Revolution die politische Unterstützung abrupt beendet und die Früchte der Arbeit nicht erntet. Die Marke „Industrie 4.0“ wird weltweit mit Deutschland assoziiert und sollte auch zukünftig genutzt werden. Es ist enorm wichtig, dass wir weiterhin Plattformen zum Austausch zwischen Gewerkschaften, Politik, Wissenschaft und Wirtschaft haben. Um diese Konstrukte bewundern uns viele andere Nationen. Aber wir müssen auch berücksichtigen, dass neue Zielsetzungen, wie zum Beispiel die „technische Souveränität“, stärker gefordert werden. Deutschland muss sich ein Stück weit technologisch unabhängiger von Asien und den USA machen. Auch beim Thema Standardisierung und Normung müssen mehr Anstrengungen unternommen werden. Deutschland muss im europäischen und internationalen Kontext z.B. durch die Formulierung von internationalen ISO-Normen Standards auch im Bereich der Informationstechnik für das industrielle Umfeld setzen. Das kostet viel Zeit und Geld. Hier braucht es eine noch stärkere Unterstützung in der nächsten Legislaturperiode.
Vereinzelt wird bereits über Industrie 5.0 diskutiert. Ist Industrie 4.0 als Leitbild bereits überholt?
Nein, absolut nicht. Industrie 4.0 ist nach wie vor hochaktuell, weil immer wieder neue Technologien aufkommen, die in die modulare Gesamtarchitektur eingefügt werden können. Dies ist zum Beispiel bei Edge-Clouds oder bei den kollaborativen Roboter der Fall gewesen, jetzt auch bei 5G in der Fabrik. Insofern bleibt das Thema topaktuell, weil wir neue Impulse aufgreifen. Und 5.0 würde ja bedeuten, dass wir eine völlig neuartige disruptive Technologie haben, die bisher nicht bekannt war. Mir hat noch niemand klar machen können, was der Innovationssprung zu 5.0 sein soll. Es gibt immer Leute, die gerne einen neuen Begriff prägen möchten, aber im Moment wäre es meiner Ansicht nach Unsinn, denn die in dem EU-Konzept postulierten „neuen“ Schwerpunkte wie mensch-zentrierte Technik, Resilienz und Nachhaltigkeit, waren wie eingangs erwähnt – schon 2011 auf unserer Roadmap zentral enthalten Anders ist es beim Begriff „Society 5.0“ – dieser liegt auf einer ganz anderen Ebene. „Society 5.0“ kommt aus Japan, wo dabei nicht über Fabrikautomatisierung und Produktion gesprochen wird, sondern darüber, wie sich die Gesellschaft durch IT wandelt. Dort wird noch die Agrargesellschaft vor der ersten industriellen Revolution mitgezählt.
Interview: Kristina Fornell und Sebastian Witte


