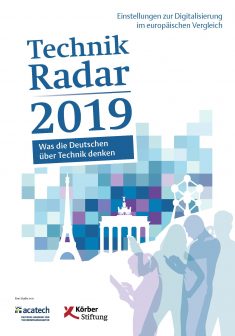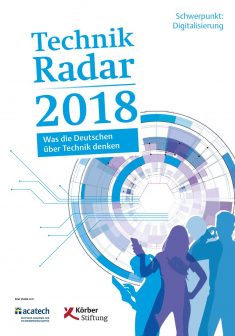acatech am Morgen: Präsidiumsmitglied Ortwin Renn diskutiert mit bayerischen Abgeordneten die Ergebnisse des TechnikRadar

München, 2. Juli 2019
Die Deutschen sind in Bezug auf die Digitalisierung ambivalent und nehmen mit dieser Haltung in Europa eine Mittelposition ein. Das zeigen die Analysen des TechnikRadar 2018 und 2019. Bei „acatech am Morgen“ im Bayerischen Landtag diskutierte Projektleiter Ortwin Renn, acatech Präsidiumsmitglied und wissenschaftlicher Direktor am Institut für Transformative Nachhaltigkeitsforschung (IASS) in Potsdam, am 27. Juni die Ergebnisse beider Studien mit Parlamentarierinnen und Parlamentariern.
„Nord gegen Süd: Europa bewertet den Einfluss der Digitalisierung gespalten“ titelte das Handelsblatt Ende Mai mit Blick auf die Ergebnisse des TechnikRadar 2019. Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentierte die Studienbefunde für Deutschland mit „Durch Deutschland geht eine digitale Kluft“. Veröffentlicht am 28. Mai, zwei Tage nach der Europawahl, hat das TechnikRadar 2019 die Frage aufgeworfen, warum Menschen in Deutschland und Europa die Digitalisierung so unterschiedlich bewerten.
Um die Gründe dafür und mögliche Herangehensweisen zur Veränderung der Situation zu diskutieren, sind rund einen Monat später, am 27. Juni, Mitglieder des Bayerischen Landtags im Maximilianeum mit TechnikRadar-Projektleiter Ortwin Renn zusammengetroffen. Das Gespräch fand im Rahmen der Veranstaltungsreihe „acatech am Morgen“ statt, mit der sich acatech regelmäßig an Abgeordnete des Bayerischen Landtags wendet, um über neue Technologien und Studienergebnisse zu informieren.
Zu Beginn ging Ortwin Renn in einem Vortrag auf die zentralen Befunde der beiden TechnikRadar-Ausgaben ein. Mit Blick auf die Ergebnisse des TechnikRadar 2018, für das rund 2000 Personen in einer repräsentativen Studie befragt wurden, verwies er zunächst auf die ambivalente Haltung der Deutschen in Bezug auf Technik: Nur etwa ein Drittel (32,9 Prozent) erwartet beispielsweise, dass Herausforderungen wie Hunger, Armut und Klimawandel mit technischer Hilfe gelöst werden können. Trotzdem oder gerade deswegen wollen die Deutschen den technischen Wandel mitgestalten: 68,7 Prozent unterstützen die Forderung, bei umstrittenen Technologien Bürgerinnen und Bürger mitentscheiden zu lassen.
In Bezug auf die Einbindung der Bevölkerung bei Fragen rund um neue Technologien könne man viel von skandinavischen Ländern lernen, sagte Ortwin Renn und leitete zu den Ergebnissen des TechnikRadar 2019 über. Für die zweite Ausgabe wurde die eigene repräsentative Befragung mit internationalen Studien verglichen. In Schweden, so Ortwin Renn weiter, werde beispielsweise schon länger zusammen mit der Zivilgesellschaft darüber diskutiert, wie neue Technologien genutzt werden sollen und welche Spielregeln dabei von Bedeutung sind. Entsprechend sei das Vertrauen in den Staat, dass dieser die Digitalisierung sinnvoll gestalten könne, auch stärker als in Deutschland.
Dieses Vertrauen, so Ortwin Renn, hänge stark davon ab, ob realistische Erwartungen an Digitalisierungsprozesse vermittelt würden. Die Politik solle in Bezug auf Technologien nicht versprechen, was sie nicht halten kann, denn so würde Misstrauen nur verstärkt. Als ein Beispiel für ein Auseinanderklaffen von Ankündigung und tatsächlicher Umsetzung nannte er die Energiewende. Hier sei man mit dem Versprechen angetreten, erneuerbaren Strom zu verbilligen – was zumindest nicht im angekündigten Maße eingelöst worden sei. Wenn Bürgerinnen und Bürger solche Erfahrungen machten, würden sie sich schnell abgehängt fühlen und mit Ablehnung reagieren.
Abschließend wollten die Abgeordneten wissen, was die Politik tun müsse, um in Technikfragen die Bevölkerung einzubeziehen. Laut Ortwin Renn müsse man hierfür zunächst klare Rahmenbedingungen für Beteiligungsformate setzen und die Anliegen des Allgemeinwohls stärker in die Technologiepolitik einfließen lassen. Man müsse zudem öffentlich die Frage diskutieren, warum Wachstum, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit durch neue Technologien zum Gemeinwohl beitragen würden. Technik dürfe nicht als Selbstzweck kommuniziert werden, so Ortwin Renn.