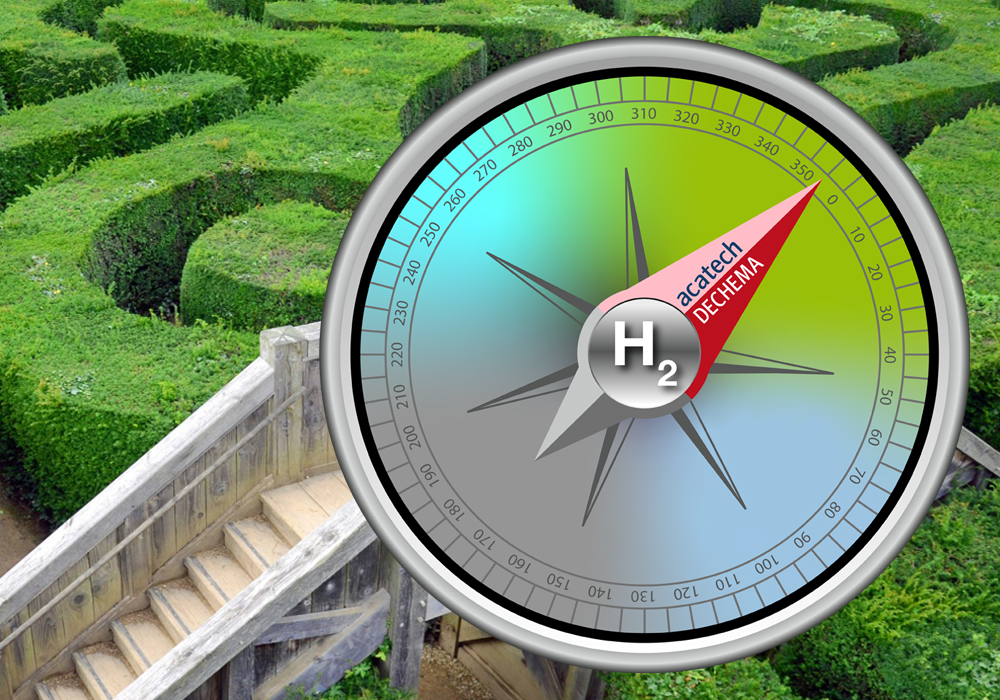acatech Themenkonferenz befasst sich mit dem Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft
![Anika Neitz-Regett [links] moderierte das Fachgespräch der Referierenden: Dirk Uwe Sauer (RWTH Aachen), Kirsten Westphal (H2Global Stiftung) und Andreas Schmid (Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ) [v.l.n.r.]. Foto: acatech](https://www.acatech.de/wp-content/uploads/2022/09/News-Foto-DSC_0513_F1_bea.jpg)
München, 21. September 2022
Wasserstoff ist das erste Element im Periodensystem. Entsprechend stand es bei der acatech Themenkonferenz „Element 1“ am 15. September in München im Mittelpunkt. Ziel der Konferenz war es, die verschiedenen Anforderungen für den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft in Deutschland aufzuzeigen und diese aus den unterschiedlichen Perspektiven der Akademie zu betrachten. Dabei diskutierten die anwesenden Expertinnen und Experten auch die Rolle von Wasserstoff für die klimapolitischen Ziele und die neuen geopolitischen Herausforderungen der Energieversorgungssicherheit.
Zu Beginn begrüßten acatech Präsident Jan Wörner und Albert Albers, Leiter des Instituts für Produktentwicklung am KIT und Sprecher des inhaltlich federführenden acatech Themennetzwerks „Produktentwicklung und Produktion“, die Gäste. Jan Wörner ging der bislang ungeklärten Frage nach, wie das Wasser auf die Erde kam, und beleuchtete die Bedeutung des Wasserstoffs in verschiedenen technologischen Anwendungen wie der Raumfahrt. Albert Albers wies darauf hin, dass trotz des Ausbaus erneuerbarer Energien der Anteil des Primärenergieimports in Deutschland seit 1990 deutlich steigt. Um diese Situation zu verbessern, seien Lösungen erforderlich.
Dirk Uwe Sauer (RWTH Aachen) gab anschließend einen Überblick und eine Einführung in das vielfältige Thema „Wasserstoff“. Dieser sei ein unverzichtbares Element für eine klimaneutrale Energie- und Grundstoffversorgung und könne vielfältig eingesetzt werden: Als Langzeitenergiespeicher, Transportmittel über große Distanzen, synthetischer Kohlenwasserstoff (Chemiegrundstoff), als Ersatzstoff für Gas und Öl sowie als Grundprodukt für synthetische Kraftstoffe im Mobilitätsbereich. Demgegenüber stehen aber weiterhin zu bewältigende Herausforderungen, wie technologische Innovationen oder die hohen Kosten für die Erzeugung von grünem Wasserstoff sowie weitere Investitionen in die Wasserstoffwirtschaft.
Die Wasserstoffwirtschaft und ihre Herausforderungen – und was ist eigentlich „weißer Wasserstoff“?
In einem kurzen Einschub im ersten Block der Tagung stellte Andrea Lübke (acatech) das von acatech koordinierte Projekt „Wasserstoff-Kompass“ vor. Ziel ist es, forschungs- und innovationspolitische Handlungsoptionen aufzuzeigen, um einen Weg für den Aufbau einer deutschen Wasserstoffwirtschaft zu skizzieren. Die bisher erarbeiteten Grundlagen machen deutlich, dass Deutschland noch davon entfernt ist, die politischen Ziele und tatsächlichen Bedarfe zu erfüllen.
Andreas Schmid (Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ) rundete den einführenden Block ab. Sein Beitrag stellte alternative Erzeugungsverfahren von Wasserstoff vor. Neben grauem (zum Beispiel aus fossilen Quellen), blauem (Erdgas mit CCS) und grünem Wasserstoff (zum Beispiel aus Biogas), die sich in der genannten Reihenfolge durch abnehmende CO2-Emission auszeichnen, habe auch der weiße Wasserstoff Potenzial. Dieser basiere auf Photosynthese, besitze aber noch ein geringes „Technology Readiness Level“.
Kirsten Westphal (H2Global Stiftung) stellte die Herausforderungen für den internationalen Wasserstoffhochlauf dar. Dazu gehöre beispielsweise, dass zunächst global gültige Vorbedingungen wie Zertifizierungen für Produkte, technische Regelwerke und Qualität geschaffen werden müssten. Auch die Infrastruktur müsse noch entsprechend ausgebaut werden. H2 Global sei ein Instrument, um den weltweiten Markthochlauf zu erleichtern, indem es Planungssicherheit und wirtschaftliche Preise – zum Beispiel für Investitionen in die Wasserstoffproduktion – ermögliche.
Walter Leitner (Max-Planck-Institut für Chemische Energiekonversion) stellte anschließend das Thema „Power-to-X“ vor. Die für die Defossilisierung der unterschiedlichen Sektoren (Stromerzeugung, Mobilität, Industrie) benötigte Energie aus erneuerbaren Quellen sei eine globale Ressource, so Walter Leitner. Für deren Transport, Speicherung und breiten Einsatz seien auch Wasserstoff bzw. Wasserstoffderivate notwendig. Entsprechend sprach er sich für internationale Partnerschaften und Märkte zur Erschließung erneuerbarer Energiequellen sowie für eine höhere Priorisierung von Power-to-X-Technologien aus.
acatech Vizepräsident erklärt Anforderungen für einen Markthochlauf von Wasserstoff-Brennzellen
acatech Vizepräsident Thomas Weber berichtete über die langjährigen Erfahrungen bei der Entwicklung der Brennstoffzellen-Technologie im Bereich Mobilität. Hier seien Entwicklungsschritte zur Serienreife erzielt worden, insbesondere im Schwerlastverkehr für die Langstrecke. Dabei sei es zu begrüßen, dass Hersteller unterschiedliche Technologie-Ansätze testeten. Anforderungen für einen erfolgreichen Markhochlauf seien neben der Akzeptanz, die Technologieentwicklung (über Skaleneffekte), ein regulativer Rahmen (zum Beispiel über eine CO2-basierte Maut zur Einpreisung von Umwelteffekten) und die Förderung einer Wasserstoff-Infrastruktur. Potenziale werden zudem noch im Schienenverkehr gesehen.
![Auf der Bühne diskutieren: acatech Vizepräsident Thomas Weber, Teresa Wich-Konrad (WEW GmbH), Walter Leitner (Max-Planck-Institut für Chemische Energiekonversion) und Henning Weege (thyssenkrupp Steel Europe) [v.l.n.r.] Moderiert von Albert Albers (KIT) [rechts vor der Bühne stehend]. Foto: acatech](https://www.acatech.de/wp-content/uploads/2022/09/DSC_0669_nachm_cut.jpg)
Hennig Weege (thyssenkrupp Steel Europe) behandelte in seinem Vortrag die Umstellung auf grünen Stahl – auf der Basis von CO2-neutralem Wasserstoff – in der Industrie. Diese sei aufgrund der hohen Emissionen in diesem Bereich ein entscheidender Hebel, um die Dekarbonisierung der Industrie zu erreichen. Damit die Transformation gelinge, müssten Wertschöpfungsketten angepasst und technologische Innovationen bei der Stahlerzeugung umgesetzt werden. Trotz der hohen Geschwindigkeit im Wandel des Sektors und einer stark steigenden Nachfrage nach grünem Stahl bestünden insbesondere noch Herausforderungen bei der Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff.
Teresa Wich-Konrad (WEW GmbH) beschrieb aus Sicht eines Start-Ups den geplanten Weg von der Handmanufaktur zur hochautomatisierten Fertigung in der weltweiten Elektrolyseurproduktion. WEW entwickelt in einem neuen Ansatz Elektrolyse-Stacks zur Umwandlung elektrischer Energie in den Energieträger Wasserstoff. Standardisierte und kostengünstige Stacks sollen sich dadurch auszeichnen, flexibel und mit wenig Aufwand für verschiedene Anwendungsbereiche und Kundenbedürfnisse angepasst werden zu können. Die Produktion und der Vertrieb dieser Stacks könne der Wasserstoffwirtschaft neue Impulse geben.
An Wasserstoff führt mit Blick auf die energie- und klimapolitischen Ziele kein Weg vorbei
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Themenkonferenz hatten mehrere Gelegenheiten, die vorgestellten Themen vertiefend zu diskutieren. Unter anderem wurde deutlich, dass die mit dem Wasserstoff verbundenen Potenziale und Aufgaben in vielen Bereichen der Industrie erkannt wurden. Hilfreich wären darüber hinaus stärkere Anreize für einen „Market Pull“ sowie eine pragmatische Regulation.

Resümierend lässt sich festhalten, dass die CO2-neutrale Energie- und Industrietransformation nur über neue Technologien erfolgen kann. Dazu wird Wasserstoff ein entscheidender Baustein sein, an dem kein Weg vorbeiführt, um die energie- und klimapolitischen Ziele durch den Europäischen Green Deal und das bundesdeutsche Klimaschutzgesetz zu erreichen.