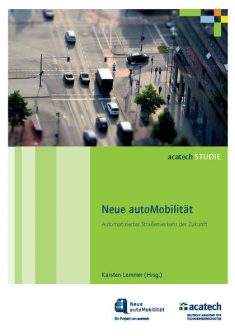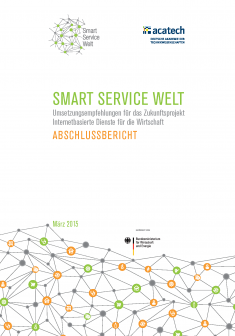Autonome Systeme: Treiber der Mobilitätswende

Goslar, 25. Januar 2018
acatech Präsident Henning Kagermann sprach am 25. Januar auf dem 56. Deutschen Verkehrsgerichtstag in Goslar über autonome Systeme und ihre Wirkung auf das Verkehrssystem, Wirtschaft und Gesellschaft. Durch das Verschmelzen der physischen und virtuellen Welt ist heute eine noch nicht dagewesene Menge an Daten verfügbar, die durch künstliche Intelligenz ausgewertet werden kann – was wiederum Chancen für neue Geschäftsmodelle eröffnet, auch im Mobilitätssektor. Zugleich aber ist ein breiter gesellschaftlicher Dialog nötig: über die Sicherheit autonomer Systeme, über ihre Auswirkungen auf die Arbeitswelt und neu zu klärenden Rechtsfragen, z.B. der Haftung.
Bereits zum 56. Mal kamen Juristinnen und Juristen sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft, Politik und Gesellschaft zum Deutschen Verkehrsgerichtstag in Goslar zusammen, um aktuelle Entwicklungen und Herausforderung für das deutsche Verkehrsrecht zu diskutieren. In diesem Jahr standen u.a. zwei technische Innovationen im Fokus: Automatisiertes Fahren und Digitalisierung in der Schifffahrt. Beide verändern den Verkehr grundlegend und bedürfen daher einer rechtlichen Bewertung, insbesondere in Bezug auf Datensicherheit und Haftung sowie auf die Risiken von vernetzten, smarten und automatisierten Mobilitätsanwendungen. In seiner Rede erläuterte acatech Präsident Henning Kagermann, welche neuen Herausforderungen autonome Systeme in diesem Zusammenhang mit sich bringen und welche Bedeutung sie für den Wirtschaftsstandort Deutschland sowie für die Gesellschaft haben.
Autonome Systeme sind Maschinen oder Softwaresysteme, die ein vorgegebenes Ziel selbstständig erreichen, ohne dass jeder Schritt dazu programmiert werden muss. Im Unterschied zu automatisierten Systemen, die einem festgelegten Handlungsplan folgen, sind sie sehr anpassungsfähig und können auf ungeplante Veränderungen in ihrer Umgebung reagieren. Sie sind dazu in der Lage, weil sie auf eine riesige Menge an Daten einer hochgradig digitalisierten und vernetzten Welt aus Maschinen und Produkten zugreifen können – ein markantes Kennzeichen der Industrie 4.0.
Dank der Industrie 4.0 sei bereits heute die Fertigung individueller Produkte zu den Kosten eines Massenprodukts möglich und eine höhere Ressourcen- und Energieeffizienz sowie eine bessere Work-Life-Balance für die Beschäftigten greifbar, so Kagermann. Zudem ermögliche die Auswertung der von intelligenten Maschinen erhobenen Daten neue Geschäftsmodelle. Denn auf Basis dieser Daten könnten Nutzern individuelle Angebote gemacht werden, die ihren Gewohnheiten, Bedürfnissen und Vorlieben entsprechen – sogenannte Smart Services. Kagermann betonte, Innovationen seien immer ein Teil der Lösung. Die Chancen der innovativen Technologien für den Wirtschaftsstandort Deutschland seien mit einer zusätzlichen Wertschöpfung von ca. 1.000 Mrd. US-Dollar bis 2035 enorm.
Die Mobilitätswende bietet viele Chancen für gesellschaftliche Verbesserungen
Der Mobilitätsmarkt verändert sich rasant. Treiber der Mobilitätswende sind Elektrifizierung, Automatisierung und Vernetzung – wodurch in Zukunft ein großer Beitrag zum Klima- und Gesundheitsschutz geleistet werden kann. Die Mobilitätswende erhöht die Sicherheit, verbessert die Lebensqualität und soziale Teilhabe und steigert die Ressourceneffizienz durch bessere Auslastung der Verkehrsmittel. Dazu Kagermann: „Der automatisierte Individualverkehr und der öffentliche Verkehr werden sich zu einem neuen, großen und sehr wettbewerbsintensiven Markt für individuelle öffentliche Verkehrsangebote verbinden. Fahrerlose Shuttles des öffentlichen Verkehrs, sogenannte ÖV-Shuttles, funktionieren als kostengünstiges Taxi oder als flexible Mitfahrzentrale. Sie bringen den Supermarkt ins Haus, ermöglichen Älteren oder Behinderten gesellschaftliche Teilhabe und fördern eine Wiederbelebung des ländlichen Raums.“
Bei jährlich über 3.000 Verkehrstoten in Deutschland stelle die Vision eines weitgehend fahrerlosen Verkehrs, basierend auf autonomen Systemen, mit signifikant weniger Verkehrsunfällen ein erstrebenswertes Ziel dar, so Kagermann. Doch sei das Handeln autonomer Systeme nicht vollständig erklärbar, eben weil sie autonom agierten und nicht jeder einzelne Schritt vorprogrammiert sei. Dies sei z.B. für Haftungsfälle von Bedeutung. Deshalb müsse man auch bedenken, dass mit dem Einsatz vollautonomer Systeme immer der Verzicht auf einen Teil der eigenen Entscheidungsautonomie verbunden sei. Viele der gesellschaftlichen Herausforderungen und ethischen Fragestellungen würden sich jedoch erst nach und nach formulieren und beantworten lassen – in einem Prozess, in dem Gesellschaft Technik verändert und Technik wiederum auf Gesellschaft zurückwirkt.
Wichtig für die sozialen, ethischen und rechtlichen Fragen sei deshalb der gesellschaftliche Dialog, erklärte Kagermann. Diesen Dialog fördert auch die 2017 vom BMBF initiierte und bei acatech angesiedelte Plattform Lernende Systeme. Sie vereint Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft, die Handlungsoptionen und Empfehlungen für den verantwortungsvollen Einsatz von autonomen Systemen entwickeln.
Weiterführende Informationen
Plattform Lernende Systeme
Nationale Plattform Elektromobilität
Deutscher Verkehrsgerichtstag