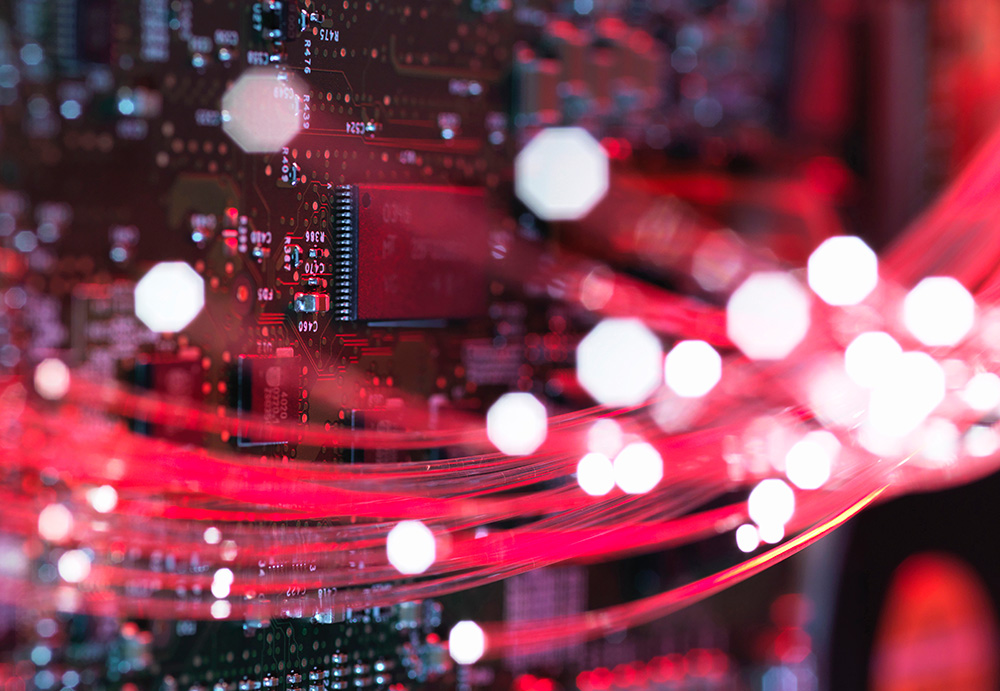Öffentlich-rechtlicher Rundfunk – Chancen und Risiken in der digitalen Welt

München, 30. Juni 2023
Der digitale Wandel verändert die Medienlandschaft und fordert auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk heraus. Wie eine große Landesrundfunkanstalt wie der Bayerische Rundfunk (BR) reagiert, welche neuen Nachrichtenformate angeboten werden und welche Auswirkungen der neue Rundfunkstaatsvertrag haben könnte, darüber sprachen Expertinnen und Experten aus Medien und Wissenschaft bei acatech am Dienstag am 27. Juni. Die Veranstaltung fand in Kooperation mit dem Zentrum für Ethik der Medien und der digitalen Gesellschaft (zem:dg) in den Räumlichkeiten der Hochschule für Philosophie in München statt.
Der Präsident der Hochschule für Philosophie (HfPh) und acatech Mitglied Johannes Wallacher freute sich, die Gäste in seiner Aula begrüßen zu können.
Laut Reuters Institute Digital News Report 2023 informieren sich 44 Prozent der 18- bis 24-Jährigen regelmäßig mittels Social Media über das Weltgeschehen. Die am häufigsten genutzte Nachrichtenquelle: Instagram. Entsprechend müssen dort auch die öffentlich-rechtlichen Sender präsent sein und Formate anbieten. Die „News WG“, entwickelt vom Bayerischen Rundfunk im Jahr 2018, ist ein solches Format.
Welche Chancen bietet der Digitale Wandel für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Zum Interview, in dem Annika Sehl (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt | zem::dg), Christoph Neuberger (Freie Universität Berlin | acatech) und Bianca Taube (Bayerischer Rundfunk), Stellung beziehen zur Frage „Welche Chancen bietet der Digitale Wandel für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?“.
In ihrem Vortrag gab Bianca Taube, „News WG“-Produktleiterin sowie Redakteurin und Moderatorin bei BR24, einen Einblick in die Entstehung, Konzeption und Entwicklung der Inhalte. Ziel des Formats sei es, verständliche Nachrichten zu liefern, die junge Erwachsene ansprechen, auch wenn man noch nie zuvor etwas von einem Thema gehört hat. Es gehe darum, politische Hintergründe zu erklären, und nicht nur Meldungen zu veröffentlichen. Ein Alleinstellungsmerkmal der News WG: die Arbeit mit der Community. Der intensive Austausch sei sehr wichtig, um Themen zu finden und Feedback zu erhalten, so Bianca Taube. Da man von Anfang an aktives Community Management betrieben habe, habe sich über die Zeit eine Diskussionskultur in den Kommentarspalten herausgebildet, die, im Vergleich zu anderen Seiten, weniger von Hass-Postings geprägt sei. Vielmehr sprächen die vielen positiven Kommentare der Nutzenden für den Erfolg des Ansatzes – auch in der schnelllebigen Social Media-Welt könne eben Interesse für Nachrichten geweckt werden, so Bianca Taube.
Welche Risiken bietet der Digitale Wandel für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Zum Interview, in dem Stefan Primbs (Bayerischer Rundfunk), Bianca Taube (Bayerischer Rundfunk) und Annika Sehl (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt | zem::dg), Stellung beziehen zur Frage „Welche Risiken bietet der Digitale Wandel für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?“.
Im anschließenden Podiumsgespräch verwies Stefan Primbs, Redakteur und Social Media-Beauftragter des BR, auf eine wichtige Beschränkung bei Social Media-Aktivitäten: auch die Reichweite der Angebote der Öffentlich-Rechtlichen hängt von den Ausspiel-Algorithmen der Plattformbetreiber ab und sind nicht beeinflussbar. Beiträge werden nicht nur Abonnenten, sondern auch nach unbekanntem Verfahren zufällig allen Plattformnutzenden angezeigt. Eine Chance, die Filterblasen zum Platzen zu bringen? Zumindest werden so Zugänge zu jüngeren Zielgruppen geschaffen, die durch klassische Kommunikationskanäle wie Homepage und Mediatheken nicht mehr erreicht werden.
Auch BR24 sei gerade dabei, das dialogfähige Community Management weiter auszubauen, berichtete Stefan Primbs weiter. Unter der Bezeichnung „Dein Argument“ könnten beispielsweise Kommentare zu Online-Artikeln, nach einer Verifikation durch die Redaktion, in einen Artikeltext aufgenommen werden. Auch auf diese Weise könne der Austausch mit den Nutzenden gefördert werden.
Annika Sehl von der Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt und Co-Leiterin des zem::dg stellte die Vorteile der Nutzung verschiedener Plattformen für die Öffentlich-Rechtlichen heraus: So könnten Diskurse mit dem Publikum jeweils dort entstehen, wo das jeweilige Publikum ist. Darüber hinaus könnten qualitätsvolle Nachrichtenformate auf Social Media-Plattformen, so Annika Sehl, Information auch dadurch fördern, dass auch Nutzende, die nicht zielgerichtet Nachrichten ansteuern, in ihren Feed auf Nachrichtenformate stoßen. Zudem lassen sich Nachrichten je nach Plattform zielgruppenspezifisch aufbereiten. Die so entstandenen zahlreichen unterschiedlichen Formate ermöglichen den Nutzenden ihren Nachrichtenkonsum zu individualisieren. Dennoch bergen die Social Media-Plattformen ein großes Spannungsfeld, denn die ausgespielten Meldungen werden durch die Plattformbetreiber auch Implizit, beispielsweise durch das vorherige Nutzungsverhalten, personalisiert, mahnte Annika Sehl. Anders als bei linearen Formaten in Funk und Fernsehen müsse bei den unterschiedlichen digitalen Formaten kein „kleinster gemeinsamer Nenner“ der Inhalte mehr gefunden werden, welcher alle verbindet – die Stärke der Information liege vielmehr in einer zielgruppenorientierten Aufbereitung, ergänzte Stefan Prims.
Arbeitsweise und Formate der Öffentlich-Rechtlichen ändern sich, die Kritik an den Einrichtungen ist weiterhin vielfältig: Skandale wie jüngst beim RBB oder die öffentlich in Zweifel gezogene politische Unabhängigkeit von Rundfunkräten haben auch in letzter Zeit für negative Schlagzeilen gesorgt. acatech Mitglied Christoph Neuberger, Freie Universität Berlin und wissenschaftlicher Geschäftsführer des Weizenbaum-Instituts für die vernetzte Gesellschaft, verwies darauf, dass die Schwächen des Systems angepackt werden: der gerade entstehende neue Rundfunkstaatsvertrag beinhalte neue, wirksame Compliance-Regelungen und ziele auf eine Bündelung der Kompetenzen zwischen den Landesrundfunkanstalten ab. Zudem sollen nach den Bestimmungen des neuen Vertrags Rundfunkräte, die die Bevölkerung repräsentieren, stärker in die Qualitätskontrolle der Inhalte eingebunden werden. Denn verlässliche „Leuchttürme“ der Information seien wichtig, um sich in Zeiten von Desinformation und Hass-Kommentaren sicher zurecht zu finden und Meldungen bewerten zu können, so Christoph Neuberger weiter.
Claudia Paganini, Hochschule für Philosophie und Co-Leiterin des zem::dg, moderierte die Diskussion. Einige Wortmeldungen zeigten die Kontroverse des Themas auf. So wurde die Frage nach der Notwendigkeit der digitalen und asynchronen Formate gestellt – schließlich nutze sie das durchschnittliche Publikum des Öffentlich-rechtlichen Rundfunks kaum, sondern wünsche sich nach wie vor ein hochwertiges lineares Radio- und Fernsehprogramm. Positiv wurde hervorgehoben, dass die sogenannten Snackable News auf den Social Media-Plattformen gut mit den ausführlichen Hintergrundberichten und Reportagen in den Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen verknüpfen ließen.