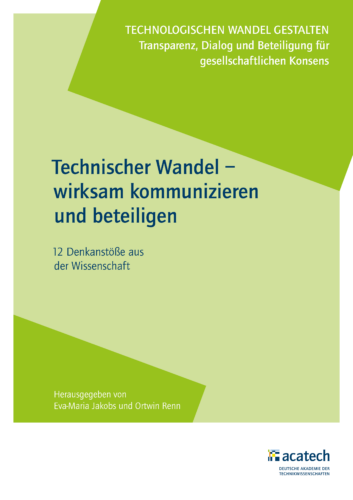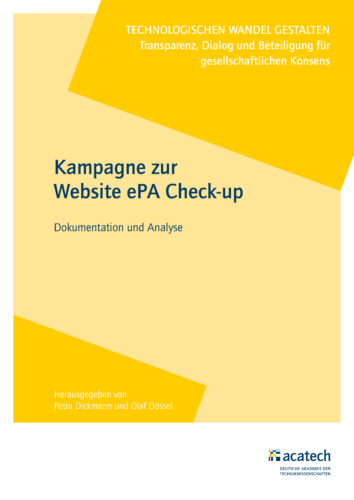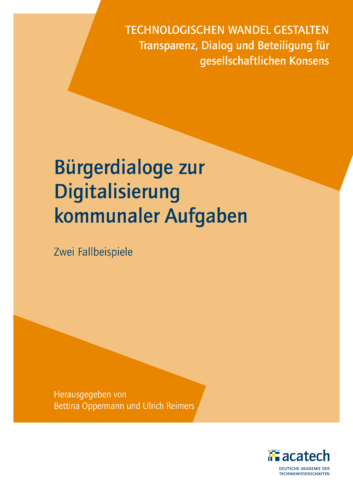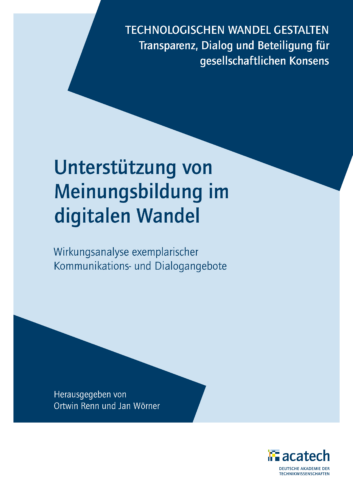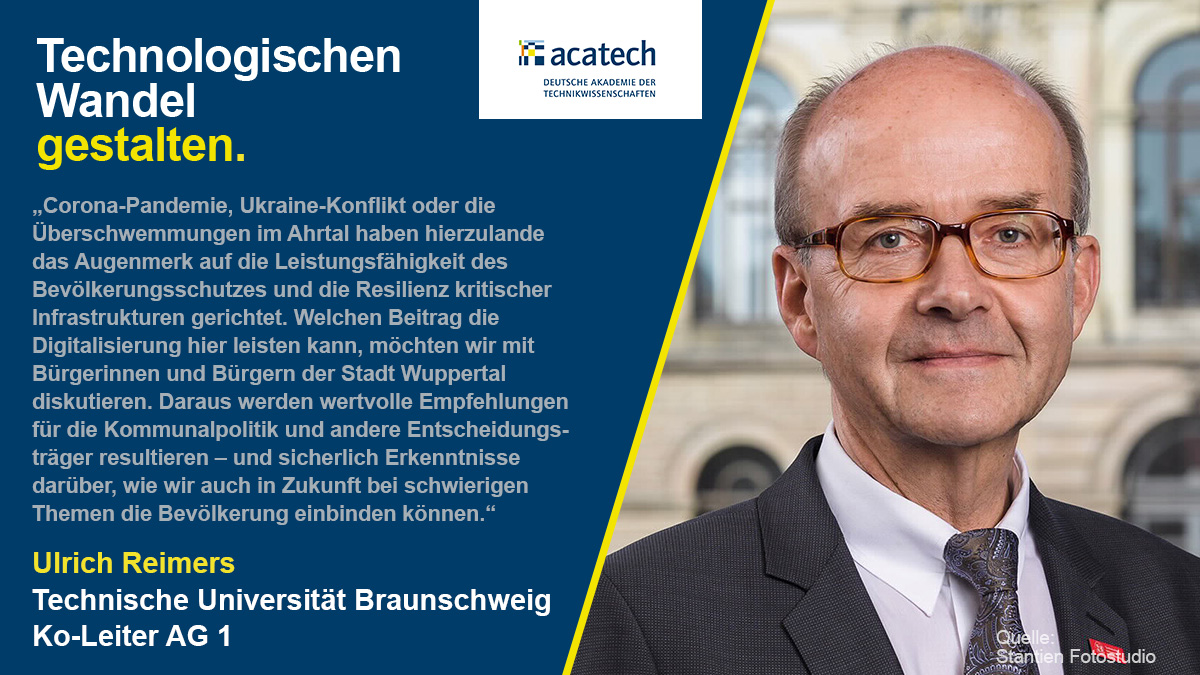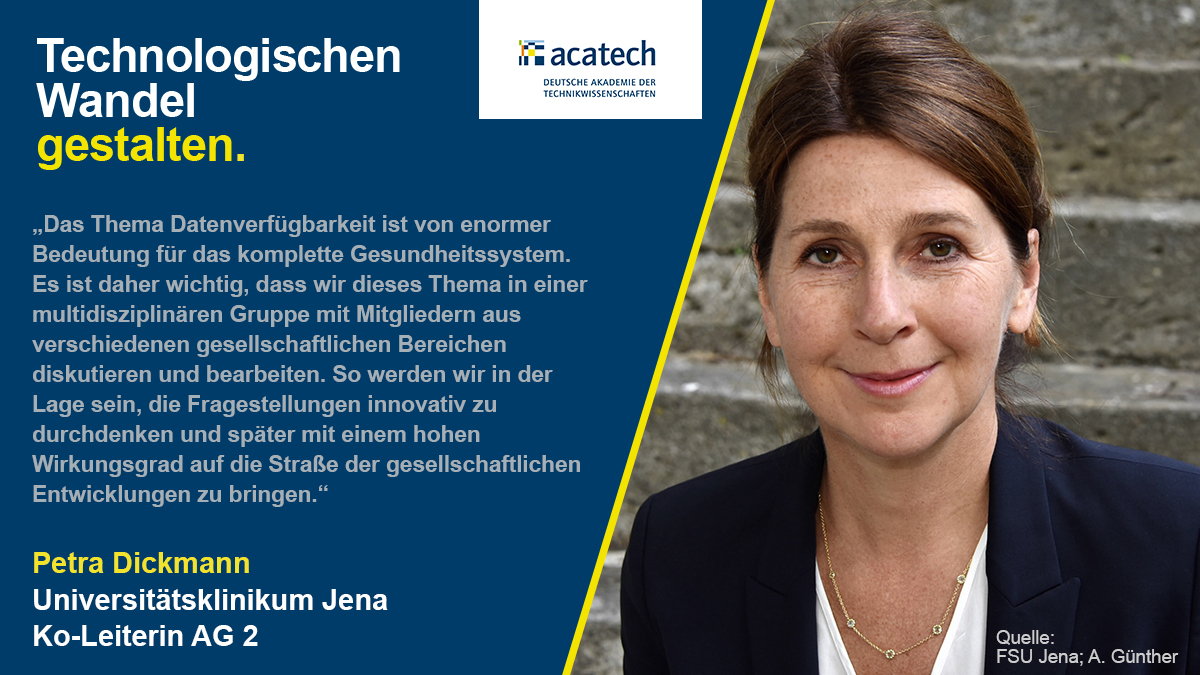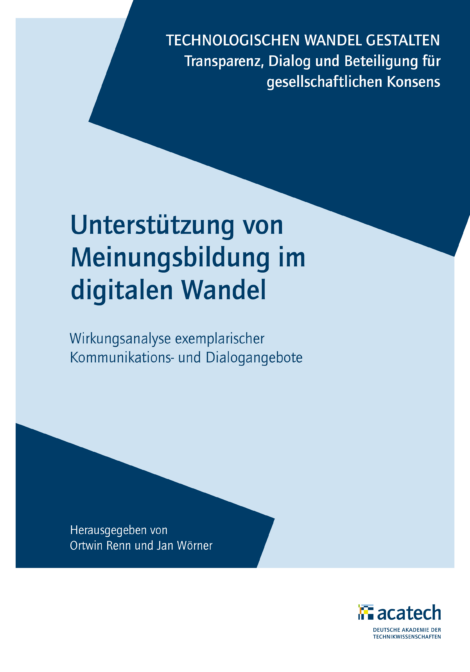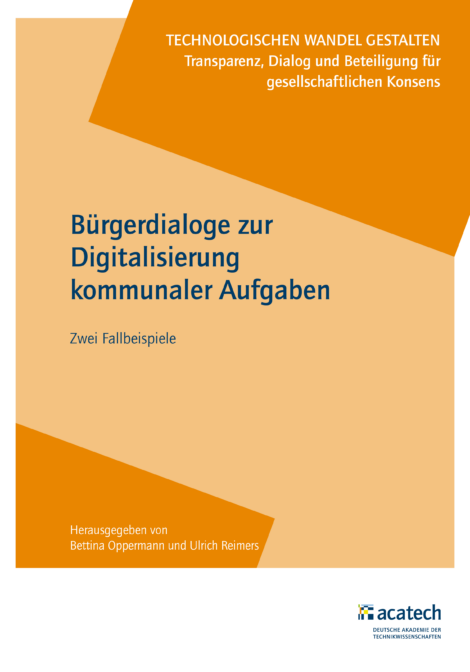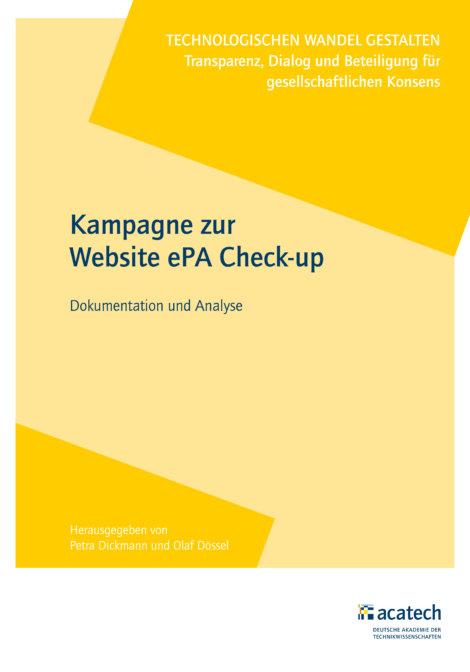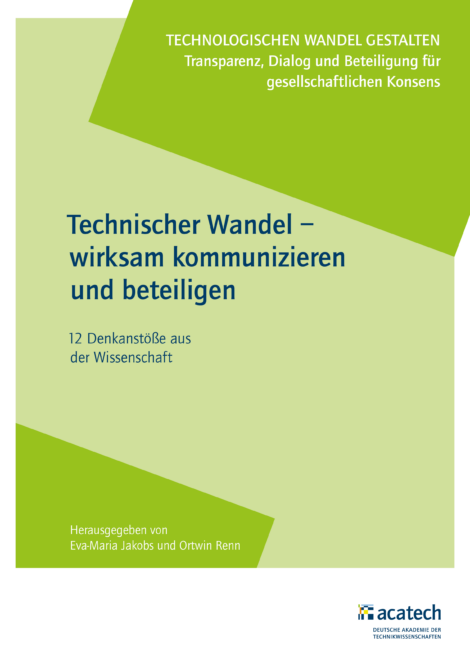Technologischen Wandel gestalten: Transparenz, Dialog und Beteiligung für gesellschaftlichen Konsens
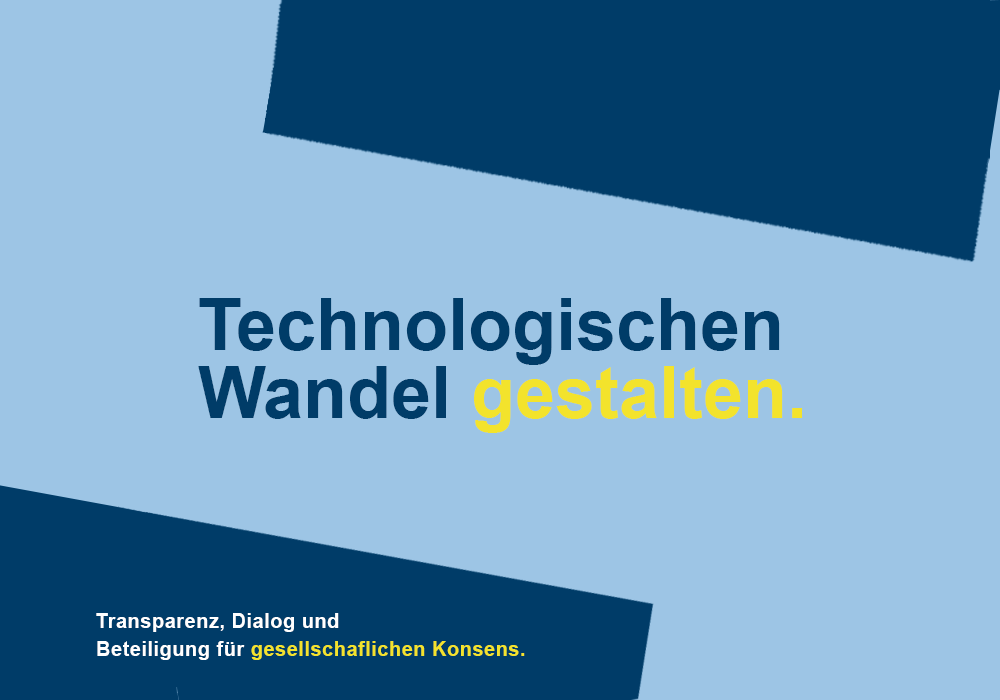
Aktuelle Veröffentlichungen aus dem Projekt
Hintergrund des Projekts
Verursacht Technik langfristig mehr Probleme, als sie löst? Das glauben mehr als 23 Prozent der Befragten im repräsentativen TechnikRadar. 45 Prozent sind bei dieser Frage unentschieden. Die Deutschen erleben den technologischen Wandel mehrheitlich ambivalent – so das Fazit der Studie (TechnikRadar 2022).
Der technologische Wandel ist eine wichtige Voraussetzung für Wohlstand sowie den Schutz von Umwelt und Klima. Der Nutzen neuer Technologien kommt nur dann zum Tragen, wenn diese von den Menschen mindestens toleriert, besser aber individuell und gesellschaftlich angenommen und gestaltet werden. Was also sind die Gründe für die Technologieskepsis in Teilen der Bevölkerung – und wie kann man ihr wirksam begegnen? Welche ganzheitliche Methodik und welche Kommunikationsformate erreichen eine nachhaltige und vertrauenswürdige Technikkommunikation?
Das sind Leitfragen des Projekts „Technologischen Wandel gestalten: Transparenz, Dialog und Beteiligung für gesellschaftlichen Konsens“. Ziel war die Entwicklung, Erprobung sowie die Evaluierung und Wirkungsmessung einer wissenschaftlich fundierten und in die Praxis umsetzbaren Gestaltung von Technikdialogen. Dabei sollte die Gesellschaft in eine frühe und kompetente Meinungsbildung bei der Gestaltung neuer Technologiefelder einbezogen werden. Gemeinsam mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern wurden die Chancen, der Nutzen und die Risiken von Technologien sachgerecht und ausgewogen diskutiert. Die Rückschlüsse aus diesen Diskussionen werden anschließend an Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und betroffene Individuen herangetragen.
Zwei Arbeitsgruppen vertieften diese Ausgangsfragen und Ziele des Projekts anhand der Themen „Resilienz und Leistungsfähigkeit der digitalen Infrastruktur“ und „Resilienz und Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems durch Datenverfügbarkeit“. Sie analysierten aktuelle Diskussionen in Politik und Gesellschaft und entwickelten Vorschläge für Dialog- und Kommunikationsinitiativen, die dann innerhalb des Vorhabens erprobt wurden.
Zentrale Fragen des Projekts:
- Was sind Gründe für eine potenzielle Technologieskepsis insgesamt und zu bestimmten Technologiefeldern in Teilen der Bevölkerung – und wie kann man ihr wirksam begegnen?
- In welchen Technologiefeldern ist das NIMBY-Problem (not in my backyard) handlungsbestimmend?
- Welche Anliegen verbinden die Menschen mit technischen Entwicklungen und wie können diese Anliegen in der Technikgestaltung und -kommunikation effektiv und verlässlich adressiert werden?
- Welche Rolle spielen bei der Technikwahrnehmung die Medien insgesamt, vor allem aber die sozialen Medien, Suchmaschinen und Algorithmen? Wie können sie Teil einer differenzierten Information sowie Meinungs- und Willensbildung über neue Technologien sein?
- Wie können Meinungsblasen und Fake News identifiziert und eingedämmt werden – und wie kann Vertrauen gegenüber wissenschaftlicher Evidenz wachsen?
- Welche Zielbilder, Narrative oder Zukunftsentwürfe zu den Themen der technologischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Innovationen bilden eine fruchtbare Basis für einen gelingenden Dialog über Risiken und Nutzen?
- Welche Erfolgsfaktoren wirksamer Kommunikation lassen sich definieren und aus guten Beispielen der Vergangenheit ableiten?
- Welche ganzheitlichen Vorgehensweisen ermöglichen eine wirksame, nachhaltige, vertrauenswürdige Technikkommunikation? Welche Kommunikationsformate eignen sich für welche Zwecke und Aufgaben?
- Wie lässt sich die Wirkung der Kommunikationsformate messen und evaluieren?
- Wie kann Vertrauen gegenüber wissenschaftlicher Evidenz wachsen? Welche Rolle spielt Vertrauen in die Wissenschaft als Voraussetzung bzw. Rahmenbedingung – und wie kann ein solches Vertrauen gestärkt werden? Wie muss Kommunikation und Partizipation aussehen, damit sie Vertrauen schafft?
- Was sind die Erwartungen an Kommunikation und Partizipation bei technischen Entwicklungen?
- Welche Zielgruppen können mit institutioneller Kommunikation erreicht werden?
- Was sind und welche Rolle spielen Verschwörungstheorien im Kontext von technologischem Wandel?
Leitung des Projekts
acatech Präsident Jan Wörner erhoffte sich einen gewinnbringenden Dialog über neue Technologien:
Ortwin Renn ist acatech Präsidiumsmitglied und leitete bis 2022 das Institut für Transformative Nachhaltigkeitsforschung IASS (jetzt RIFS) in Potsdam. Der Techniksoziologe erklärte, warum im Projekt Expertinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen teilgenommen haben:
Mitglieder des Steuerkreises
Leitung
- Prof. Dr.-Ing. Jan Wörner
acatech Präsident/Projektleiter - Prof. Dr. Drs. h.c. Ortwin Renn
Ehemaliger wissenschaftlicher Direktor des Instituts für transformative Nachhaltigkeitsforschung IASS (jetzt RIFS); acatech Präsidium/Projektleiter
Mitglieder des Steuerkreises
- Henry Alt-Haaker
Bereichsleiter Strategische Partnerschaften und Robert Bosch Academy der Robert Bosch Stiftung GmbH - Alexander Bilgeri
Leiter der Konzernkommunikationsstrategie, Konzernaussagen und Kommunikationskanäle der BMW Group - Matthias Mayer
Leiter Bereich Wissenschaft, Körber-Stiftung - Lilian Knobel
Klaus Tschira Stiftung gGmbH - Dr. Karen Köhler
Ambassador der Bayer Science & Education Foundation - Dr. Ralf Schneider
Group CIO, Allianz SE - Sabia Schwarzer
Leiterin Group Communications, Branding & Corporate Affairs bei Merck KGaA - Dr. Nina Smidt
Geschäftsführende Vorständin / Sprecherin der Siemens Stiftung - Richard Gaul
acatech Senator - Prof. Dr. Armin Grunwald
Karlsruher Institut für Technologie KIT; Leiter des Büros für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag; acatech Präsidium - Manfred Rauhmeier
acatech Geschäftsführer - Martina Schraudner
Wissenschaftliche Leiterin, Fraunhofer IAO | Center for Responsible Research and Innovation CeRRI
Arbeitsgruppe 1: „Resilienz und Leistungsfähigkeit der digitalen Infrastruktur“
Digitale Anwendungen sind Teil des Alltags. Ihre Grundlage bilden die dazugehörigen digitalen, technischen Infrastrukturen. Deutschland will den Ausbau dieser Infrastrukturen weiter vorantreiben. Doch zunächst gilt es, die Bevölkerung bei Fragen zum Nutzen und den Risiken einzubinden. Für viele Kommunen und ihre Bürgerinnen und Bürger ist noch offen, welcher Grad an Digitalisierung tatsächlich angestrebt werden sollte. Um hierbei mehr Klarheit zu schaffen, führte die Arbeitsgruppe „Resilienz und Leistungsfähigkeit der digitalen Infrastruktur“ mit zwei Partnerkommunen Bürgerdialoge in unterschiedlichen Themenfeldern durch. Als Format für die Bürgerdialoge wurden Fokusgruppen gewählt, eine spezifische Form der Gruppendiskussion aus der sozialwissenschaftlichen Forschung.
Im brandenburgischen Wittenberge teilten Bürgerinnen und Bürger sowie Vertreterinnen und Vertreter von kommunalen Unternehmen ihre Meinungen und Präferenzen zur Digitalisierung der Verwaltung mit der Kommune. Die Stadtverwaltung möchte die Resultate dieser Dialoge für den Ausbau ihrer digitalen Angebote im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) nutzen. Die Fokusgruppen bildeten dabei den Auftakt für einen längerfristigen Austausch mit der Bevölkerung.
In Wuppertal stand dagegen der Bevölkerungsschutz im Mittelpunkt der Gespräche. Bürgerinnen und Bürger diskutierten dabei in mehreren Gruppen, wie digitale Technik im Katastrophenfall einzusetzen ist und auch wie Menschen mit unterschiedlichen Selbstschutzfähigkeiten den Umgang damit handhaben wollen. Die Stadtverwaltung nutzte die Erkenntnisse für die parallel entstehende Smart City-Strategie.
Bei beiden kommunalen Projekten wurde untersucht, inwiefern Fokusgruppen zur sachgerechten und fundierten Meinungsbildung und damit zu einem sinnvollen und mehrheitsfähigen Maß an technischem Wandel in Kommunen beitragen können. Die Erkenntnisse aus den beiden Fallstudien gehen in zwei Publikationen ein: Die inhaltlichen Ergebnisse und Rückschlüsse sowie Erkenntnisse zur Durchführung von Fokusgruppen werden in der Publikation „Bürgerdialoge zur Digitalisierung kommunaler Aufgaben. Zwei Fallbeispiele“ aufgegriffen. Die Erkenntnisse zum meinungsbildenden Effekt von Fokusgruppen als Technikdialog sind in die Gesamtprojektpublikation „Unterstützung von Meinungsbildung im digitalen Wandel. Wirkungsanalyse exemplarischer Kommunikations- und Dialogangebote“ eingeflossen.
Leitung der Arbeitsgruppe 1 (AG 1)
Die Umweltplanerin Bettina Oppermann forscht am Institut für Freiraumentwicklung an der Universität Hannover und nimmt Bedenken der Bevölkerung zu technologischen Entwicklungen ernst und wollte dazu in den Dialog treten.
Der Ingenieur Ulrich Reimers, der laut International Electrotechnical Commission zu den wichtigsten Vordenkern der Elektrotechnik weltweit zählt, wünschte sich eine Diskussion über digitale Infrastrukturen.
Mitglieder der Arbeitsgruppe 1
Leitung
- Prof. Dr.-Ing. Bettina Oppermann
Fachgebiet Freiraumpolitik und Planungskommunikation, Universität Hannover - Prof. a. D. Dr.-Ing. Ulrich Reimers
Institut für Nachrichtentechnik, TU Braunschweig
Mitglieder der Arbeitsgruppe 1
- Prof. Dr. Frank Brettschneider
Lehrstuhl für Kommunikationswissenschaft, insb. Kommunikationstheorie, Universität Hohenheim - Prof. Dr. Achim Enders
Institut für Elektromagnetische Verträglichkeit, TU Braunschweig - Benedikt Ernst
Head of Strategy Performance Materials, Merck KGaA - Harald Geywitz
Repräsentant Berlin Government Relations, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG - Prof. Dr.-Ing. Helmut Holzapfel
Leiter, Zentrum für Mobilitätskultur Kassel - Fritz-Uwe Hofmann
Leiter Politische Interessenvertretung Deutschland und Hauptstadtrepräsentanz, Deutsche Telekom AG - Prof. Dr. Alexander Lerchl
Professor of Biology and Ethics of Science & Technology, Jacobs University Bremen - Frank Ulmer
Geschäftsführer, Kommunikationsbüro Ulmer GmbH - Dr. Mario Rehse
Head of Public Affairs, United Internet AG - Prof. Dr. Mike S. Schäfer
Department of Communication and Media Research / Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung, Universität Zürich - Eva Wolfangel
Technikjournalistin
Arbeitsgruppe 2: „Resilienz und Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems durch Datenverfügbarkeit“
Der erste Besuch bei einer Haus- oder Facharztpraxis erfordert auch immer das Ausfüllen einer Datenschutzerklärung. Nicht umsonst, denn es gibt kaum sensiblere Daten als medizinische. Die Digitalisierung verändert jedoch die Logik der Gesundheitsbranche: Immer mehr Menschen tracken etwa Gesundheitsparameter in Apps. Das ist praktisch – nicht selten zahlt man dabei aber auch mit den eigenen Daten, vor allem wenn der digitale Dienst aus einem Land mit schwacher Datenregulierung stammt.
Aber neben den Risiken – etwa Manipulation, Diebstahl oder Missbrauch von Gesundheitsdaten – birgt die Nutzung von Gesundheitsdaten auch viele Vorteile auf individueller Ebene und gesamtgesellschaftlich. So lassen sich durch die Analyse möglichst großer medizinischer Datensätze auch Erkenntnisse über medizinische Zusammenhänge oder sogar über seltene Erkrankungen gewinnen.
Aktuell hinkt die Digitalisierung in Deutschland gegenüber anderen Ländern hinterher. Deshalb können Gesundheitsdaten kaum für die Versorgung und Forschung genutzt werden. Etwa durch die Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA), einer digitalisierten Form der Patientenakte auf Papier, soll sich die Datenverfügbarkeit im deutschen Gesundheitssystem ändern: Alle Versicherten sollen die digitale Akte für die Ablage und Weiterverwendung ihrer eigenen Patientendaten nutzen können. Zukünftig soll auch die Möglichkeit bestehen, die eigenen Daten über die ePA für die medizinische Forschung bereitzustellen. Bislang weiß allerdings, so zeigt es eine Umfrage von acatech und Körber-Stiftung, nur ein geringer Prozentsatz der Bevölkerung von dieser Möglichkeit oder nutzt sie.
Die Maßnahmen der AG 2 waren darauf ausgerichtet, den gesellschaftlichen Diskurs über die Nutzung von Gesundheitsdaten am Beispiel der elektronischen Patientenakte zu stärken. In Fokusgruppen, einem sozialwissenschaftlichen Format der Gruppendiskussion, wurden Laien und Expert:innen zu Einstellungen, Bedarfen, Hürden, Risiken und Chancen zur ePA befragt. Die Website ePA Check-up soll als digitale Orientierungshilfe zum sachgerechten Meinungsbildungsprozess der Bürger:innen rund um die elektronische Patientenakte beitragen, indem über Risiken und Chancen ausgewogen aufgeklärt und informiert wird. Der ePA Check-up wurde evaluiert und die meinungsbildende Wirkung gemessen. Die Ergebnisse aus den Diskussionsrunden der Fokusgruppen sowie der Evaluation und Wirkungsmessung sind in die Gesamtprojektpublikation „Unterstützung von Meinungsbildung im digitalen Wandel. Wirkungsanalyse exemplarischer Kommunikations- und Dialogangebote“ eingegangen. Diese Publikation erscheint demnächst. Der Erfolg der Marketing-Kampagne wird in der bereits erschienenen Publikation „Kampagne zur Website ePA Check-up. Dokumentation und Analyse“ diskutiert.
Leitung der Arbeitsgruppe 2 (AG 2)
Wie Gesundheitsdaten zum Nutzen für den Patienten eingesetzt werden können, veranschaulichte Olaf Dössel, Leiter des Instituts für Biomedizinische Technik am Karlsruher Institut für Technologie:
Petra Dickmann vom Universitätsklinikum Jena unterstrich die Bedeutung einer multiperspektivischen Auseinandersetzung mit dem Thema Gesundheitsdaten:
Mitglieder der Arbeitsgruppe 2
Leitung
- PD Dr. med. Dr. phil. Petra Dickmann
Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Bereich Public Health, Universitätsklinikum Jena - Prof. Dr. Olaf Dössel
Institut für Biomedizinische Technik Karlsruher Institut für Technologie KIT
Mitglieder der Arbeitsgruppe 2
- Daniel Bahr
Vorstand Allianz Private Krankenversicherung; Bundesminister a.D. - PD Dr. Gaby-Fleur Böl
Abteilungsleiterin Risikokommunikation, Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) - Franz-Helmut Gerhards
Chief Digital Officer, DAK-Gesundheit - Prof. Dr.-Ing. Horst Hahn
Institutsleiter Fraunhofer-Institut für Digitale Medizin MEVIS; AG Digitale Medizin, FB 3, Universität Bremen - Dr. Friederike Hendriks
Leitung der Nachwuchsforschergruppe „Communicating Scientists: Callenges, Competencies, Contexts (fourC)“, TU Braunschweig - Michael Heutmann
Geschäftsführer BITMARCK Service GmbH - Dr. Karen Köhler
Vice President, Head of R&B & Science Engagement, Bayer AG - Prof. Dr. Cordula Kropp
Lehrstuhl für Soziologie mit dem Schwerpunkt Risiko- und Technikforschung, Universität Stuttgart; Direktorin des Zentrums für Interdisziplinäre Risiko- und Innovationsforschung der Universität Stuttgart (ZIRIUS) - Nicola Kuhrt
Medizinjournalistin - Prof. Dr. Jörn Müller-Quade
Lehrstuhl für Kryptographie und Sicherheit, Karlsruher Institut für Technologie KIT - Dr. Bernd Ohnesorge
President Europe, Middle East & Africa, Siemens Healthineers - Prof. Dr. Hermann Requardt
acatech Präsidium - Prof. Dr. Indra Spiecker genannt Döhmann
LL.M., Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Informationsrecht, Umweltrecht, Verwaltungswissenschaft, Universität Frankfurt - Prof. Dr. Christiane Woopen
Heinrich-Hertz-Professur Life Ethics im Transdisziplinären Forschungsbereich „Individuen, Institutionen und Gesellschaften“, Universität Bonn
Kommunikationswissenschaftliche Expertisebank (AG 0)
Die Kommunikationswissenschaftliche Expertisebank (AG 0) setzte sich aus Expertinnen und Experten der Wissenschafts- und Technikkommunikation, Technikfolgenabschätzung, Psychologie, Evaluation sowie Umsetzung von Wissenschaftskommunikation in die Praxis zusammen. Sie unterstützte die beiden Arbeitsgruppen mit kommunikationswissenschaftlichen Erkenntnissen und identifizierte übergreifende Ergebnisse der Arbeitsgruppen.
Darüber hinaus griffen die Expertinnen und Experten die gesellschaftlich relevanten zentralen Fragen im Kontext aktueller Technikkommunikation auf. Die Beiträge sind in die Publikation „Technologischer Wandel – wirksam kommunizieren und beteiligen. 12 Denkanstöße aus der Wissenschaft“ eingegangen. Der Sammelband richtet sich an Institutionen und Organisationen, die wissenschaftsbasierte Kommunikation und Verfahren zur Partizipation über Technik mit Schwerpunkt auf neuen Technikanwendungen bereits durchführen oder planen.
Mitglieder der Kommunikationswissenschaftlichen Expertisebank (AG 0)
Leitung
- Prof. Dr. Eva-Maria Jakobs
Direktorin des Human-Computer Interaction Center, LuF Textlinguistik und Technikkommunikation, RWTH Aachen University - Prof. Dr. Dr. h.c. Ortwin Renn
Ehemaliger wissenschaftlicher Direktor des Instituts für transformative Nachhaltigkeitsforschung IASS; acatech Präsidium/Projektleiter
Weitere Mitglieder der Kommunikationswissenschaftlichen Expertisebank
- Prof. Dr. Martin W. Bauer
Director of MSc Social & Public Communication, Professor of Social Psychology & Research Methodology, Department of Psychology and Behavioural Science, London School of Economics and Political Science - Prof. Dr. Stefan Böschen
Lehrstuhl für Technik und Gesellschaft, RWTH Aachen - Prof. Dr. Frank Brettschneider
Lehrstuhl für Kommunikationswissenschaft, insb. Kommunikationstheorie, Universität Hohenheim - Sen.-Prof. Dr. Rainer Bromme
Institut für Psychologie, Universität Münster - Richard Gaul
acatech Senator - Prof. Dr. Armin Grunwald
Leiter des Instituts für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse am Karlsruher Institut für Technologie; Leiter des Büros für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag; acatech Präsidium - Prof. Dr. Nina Janich
Germanistische Linguistik, Technische Universität Darmstadt - Prof. Dr. Cordula Kropp
Lehrstuhl für Soziologie mit dem Schwerpunkt Risiko- und Technikforschung, Universität Stuttgart; Direktorin des Zentrums für Interdisziplinäre Risiko- und Innovationsforschung der Universität Stuttgart (ZIRIUS) - Beatrice Lugger
Geschäftsführerin und Direktorin, Nationales Institut für Wissenschaftskommunikation (NaWik) - Prof. Dr. Frank Marcinkowski
Lehrstuhl für Kommunikations- und Medienwissenschaft I, Universität Düsseldorf - Prof. Dr. Hans Peter Peters
Honorarprofessor am Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, Freie Universität Berlin - Dr. Christian Rauch
Geschäftsführer und Gründer, STATE - Prof. Dr. Lucia A. Reisch
El-Erian Professor of Behavioural Economics and Policy and Director of the El-Erian Institute, University of Cambridge; Fellow, Queens’ College Cambridge - Prof. Dr. Mike S. Schäfer
Department of Communication and Media Research / Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung, Universität Zürich - Dr. Dagmar Simon
Geschäftsführerin EVACONSULT; Gastwissenschaftlerin der Forschungsgruppe „Digitale Mobilität und gesellschaftliche Differenzierung“, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung - Prof. Dr. Helmuth Trischler
Leiter Bereich Forschung, Deutsches Museum
Gesellschaftspolitischer Beirat
Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlicher gesellschaftlicher Perspektiven, zum Beispiel aus Wissenschaft, Unternehmen, Verbänden oder Medien, bildeten den Gesellschaftspolitischen Beirat und diskutierten den Wandel und die Entwicklung der Gesellschaft im Kontext des technologischen Fortschritts. Der Beirat wirkte dabei als Soundingboard für die Projektarbeit.
Mitglieder des Gesellschaftspolitischen Beirats
Leitung
- Eva Maria Welskop-Deffaa
Präsidentin des Deutschen Caritasverband e.V. - Ulrich Wilhelm
Vorsitzender der FAZIT-Stiftung
Mitglieder des Gesellschaftspolitischen Beirats
- Prof. Dr. Alexandra Borchardt
Medien-Wissenschaftlerin und Autorin - Friederike Fabritius
Neurowissenschaftlerin und Leadership-Expertin - Dr. Stefan von Holtzbrinck
Verleger, Vorsitzender der Geschäftsführung der Holtzbrinck Publishing Group - Markus Jerger
ehemaliger Präsident des Europäischen Unternehmerverbands - Prof. Lutz Eckstein
Präsident des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) - Prof. Dieter Kempf
Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), 2017-2020 - Prof. Dr. Renate Köcher
Geschäftsführerin des Instituts für Demoskopie Allensbach (IfD) - Prof. Dr. Carsten Könneker
Vorstand HITS-Stiftung - Jörg-Andreas Krüger
Präsident des NABU (Naturschutzbund Deutschland) e.V. - Dr. Sicco Lehmann-Brauns
Director Research and Innovation Policy Siemens AG/Corporate Technology - Matthias Mayer
Leiter Bereich Wissenschaft, Körber-Stiftung - Dr. Bernhard Rohleder
Hauptgeschäftsführer des Bitkom e.V. - Maximilian Schöberl
Generalbevollmächtigter, BMW AG - Dr. Nina Smidt
Geschäftsführende Vorständin / Sprecherin der Siemens Stiftung - Prof. Dr. Katharina Theis-Bröhl
Professorin für Physik in den Studiengängen Nachhaltige Energie- und Umwelttechnologien sowie Process Engineering and Energy Technology - Prof. Dr. Dr. Johannes Wallacher
Präsident der Hochschule für Philosophie München
Die Projektmitglieder beteiligten sich ehrenamtlich an der Arbeit in den Projektgremien und konnten im Rahmen des Projekts auch als Auftragnehmer zum Einsatz kommen.